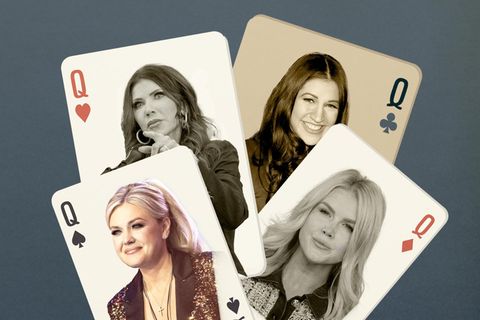Wie viel Macht haben die UN?
Rein rechtlich haben die UN sehr große Macht, denn das Gewaltmonopol liegt beim Sicherheitsrat. Völkerrechtlich ist die Frage schon etwas schwieriger zu beantworten. Das Problem des Völkerrechts überhaupt ist, dass es keine übergeordnete Gerichtsbarkeit gibt. Doch die Schwäche des Völkerrechts gegenüber einer Großmacht ist eindeutig. Die USA zum Beispiel setzten sich ja nicht bewusst über das Völkerrecht hinweg, sondern legen das Selbstverteidigungsrecht in einer für sie geeigneten Weise aus. Hier endet die Macht, nicht aber das Recht der UN.
Brauchen wir die UN überhaupt noch?
Auf jeden Fall! Die UN haben, bei all ihren Schwächen, unglaublich viel bewirkt. Vor allem haben sie den Gedanken der Menschenrechte vorangetrieben, der zu Beginn nur als Ziel in der Charta festgeschrieben war. Außerdem konnten sie viele Erfolge bei der Friedenssicherung verbuchen. Andererseits kann das etwas starre System des Sicherheitsrats manchmal nötige Entscheidungen blockieren. Ohne einen Konsens der großen Mächte erreichen sie gar nichts. Ist, wie im aktuellen Fall der Irak-Krise, ein ständiges Mitglied selbst in den Konflikt involviert, wird es besonders schwierig.
Wann können die UN eingreifen?
Die UN können durchaus gewaltsame Maßnahmen anordnen, aber eben nur wenn eine Bedrohung des Friedens vorliegt. Insgesamt gibt es einen großen Beurteilungsspielraum. Muss man den ersten Schuss erst abwarten oder genügt schon der Finger am Abzug? Fest steht: Solange keine Friedensbedrohung vorliegt, bleibt den Staaten das Selbstverteidigungsrecht.
Liegt eine Friedensbedrohung jetzt vor?
Nein. Der Unterschied, ob der Sicherheitsrat vorgehen darf und das Recht auf Selbstverteidigung werden auch von der Bundesregierung in unsäglicher Weise vermischt. Der Sicherheitsrat darf vorgehen, wenn eine Bedrohung des Friedens festgestellt wird. Diese Entscheidung bindet dann alle Mitgliedsstaaten. Das bedeutet nicht, dass sie sich auch mit Waffengewalt beteiligen müssen, sondern verpflichtet sie nur zur Solidarität. Ich halte es für schlecht, gänzlich aus der Diskussion im Sicherheitsrat auszutreten. Denn das hat zur Folge, dass einem irgendwann gar nicht mehr zugehört wird. Man muss die USA überzeugen. Man muss das differenziert betrachten und sich nicht von vornherein festlegen, sondern abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Außenpolitisch ist schnell sehr viel Porzellan zerschlagen. Es gilt die hohe Kunst der Diplomatie.
Liegt eine Schwächung der UN im Interesse der einzig verbliebenen Supermacht?
Es gibt sicherlich, wie in jeder Großmacht, auch in den USA Einzelne, die eine eventuelle Schwächung der UN wünschen. Andere wiederum sehen das nicht im Interesse eines demokratischen Rechtsstaates. Die USA haben die UN ja schließlich ins Leben gerufen. Und sie haben den USA auch schon einigen Nutzen gebracht. Ohne die UN wäre der Ostblock nicht in Schwierigkeiten geraten und die ehemalige Sowjetunion nicht zerfallen, als diese Länder sich mit der Menschenrechtsfrage auseinander setzen mussten. Es kann also kein objektives Interesse der Amerikaner an einer Schwächung der UN bestehen.
Professor Dr. Dieter Dörr
ist Professor für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht sowie Medienrecht an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und Direktor des Mainzer Medieninstituts.
Forschungsschwerpunkte:
deutsches und europäisches Verfassungs- und Medienrecht, Selbstbestimmungsrecht der Völker
Was bleibt vom Völkerrecht, wenn sich die USA über UN-Entscheidungen hinweg setzen?
Es würde das Völkerrecht auf jeden Fall stark beschädigen. Das Selbstverteidigungsrecht ist ein Riesenfortschritt gewesen. Es wäre doch schrecklich, wenn wir wieder zum gerechten Krieg zurückkehren. Den gab es immerhin schon im Mittelalter und bei Augustinus.
Gibt es Sanktionen für den Fall, dass das Völkerrecht gebrochen wird und welche wären das?
Natürlich gibt es Sanktionen. Sie können sich zunächst unfreundlich einem Land gegenüber zeigen, Repressalien erwirken, Verträge aufkündigen, Handelsbeziehungen abbrechen. Auch können die UN dem zu Unrecht Angegriffenen zu Hilfe kommen. Das alles hat natürlich in Bezug auf die Großmacht USA nur eine geringe Wirkung. Das Völkerrecht ist eben ein unvollkommenes Recht, das nicht einfach einen Gerichtsvollzieher schicken kann um Entscheidungen zu vollstrecken.
Wären die UN machtvoller, wenn sie die schon lange von ihr geforderte schnelle Eingreiftruppe hätten?
Ein Stück weit natürlich. Man hat das ja immer überlegt. Aber auch hier geht es nicht ohne Konsens. Die UN müssten sich ja trotzdem der Soldaten der einzelnen Staaten bedienen. Auch deswegen ist es wichtig, die USA zu überzeugen, dass die Entscheidung eines gewaltsamen Eingriffs im Irak den UN obliegt. Die USA können sich auf Dauer nicht gegen alle stellen. Oft sind sich die anderen Staaten ihrer Macht nur nicht so bewusst. Und Europa ist sich nicht mal einig.
Wie könnten die UN effektiver werden?
Die UN als Organisation lassen sich fast nicht effektiver gestalten. Eventuell könnte man über eine ausgewogenere Besetzung im Sicherheitsrat nachdenken, in dem ja Europa sehr stark vertreten ist. Ingesamt wird die UN nur effektiver, wenn die großen Staaten sie akzeptieren. Es sah schon mal viel besser aus mit den UN, weil die Sicherheitsratsmitglieder gemeinsam Probleme lösen wollten. Es ist also ein temporäres Problem der UN und kein grundsätzliches. Effektiver kann sie nur noch auf regionaler Ebene werden. Die EU zum Beispiel ist um einiges effektiver. Allerdings dreht es sich ja hierbei auch um ein viel kleineres Gebiet. Nur ein Weltstaat wäre noch effektiver. Aber, um es mit Kant zu sagen:"Was ist, wenn der Weltstaat ein Unrechtsregime wird? Dann kann man nicht mal mehr auswandern." Das Völkerrecht ist kein beständiger Fortschritt. Manchmal waren wir im Mittelalter entwicklungsgeschichtlich weiter als in der frühen Neuzeit. Doch es lohnt sich immer für Gewaltverbot und Menschenrechte zu streiten.
Interview: Maike Dugaro