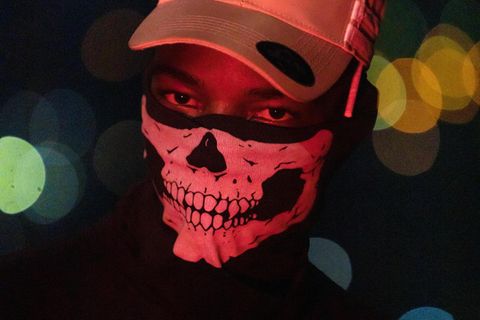Morddrohungen, Finanzspritzen und Machtverlust: Die Kirche in Lateinamerika verliert zunehmend an Einfluss, weil die überwiegend sozialistischen Regierungen ihre Vorstellungen durchsetzen. Für konservatives Gedankengut ist in den neuen Verfassungen des Kontinents kein Platz mehr. Viele Beobachter fühlen sich in die Zeit der Befreiungstheologie zurückversetzt, diesmal mit umgekehrten Vorzeichen. Es war die Zeit des Vietnam-Krieges, der Militärdiktaturen und der Nachwehen der Revolution auf Kuba: Als sich die lateinamerikanischen Bischöfe in den späten Augusttagen des Jahres 1968 in Medellin zu ihrer legendären Vollversammlung trafen, erlebte die Welt bewegte Zeiten und die katholische Kirche ihre eigene kleine Revolution. In der kolumbianischen Stadt schlug die Geburtsstunde der Befreiungstheologie. Ein in der Kirche bis heute umstrittenes Gedankengut, das vor allem den Kampf der Bevölkerung gegen die politische Unterdrückung auch gegen die Armut zum Inhalt hatte.
Ideen der Befreiungstheologie bleiben populär
In fast allen Ländern Lateinamerikas hatten brutale Militärdiktaturen die Macht und in den katholischen Basisgemeinden des Kontinents entwickelte sich die Idee der "Theologie der Befreiung". Das revolutionäre Streben setzte sich allerdings nicht durch, auch weil die Kirche gegen den Grundsatz der politische Neutralität nicht verstoßen wollte und die ein oder andere Idee konservativen Kirchenkräften zu verwegen erschien. Rund 40 Jahre später sind die Militärdiktaturen in Lateinamerika zwar Geschichte, doch die populären Ideen der Befreiungstheologie vor allem in armen Bevölkerungsschichten erleben in den überwiegend sozialistisch regierten Ländern des Kontinents ihre Wiedergeburt.
Ob in Ecuador, Paraguay oder Venezuela: Die Gräben zwischen den konservativen Kräften der Kirche und den linken Regierungen könnten derzeit nicht tiefer sein. Mit Fernando Lugo hat in Paraguay sogar ein ehemaliger katholischer Bischof und Anhänger der Befreiungstheologie die politische Macht übernommen. Mit Spannung beobachtet die einflussreiche katholische Kirche nun, wie Lugo als Staatspräsident die Werte seines bisherigen "Arbeitgebers" in der neuen Funktion verteidigt. Ex-Bischof Lugo ist mit seinem Spagat zwischen politischen und kirchlichen Engagement so etwas wie das lebende Symbol des kirchlichen Widerspruchs geworden.
Einerseits soll und will sich die Kirche politisch neutral verhalten, andererseits rufen schreiende soziale Ungerechtigkeiten und bittere Armut nach tiefgreifenden Veränderungen. Für den Vorsitzenden der lateinamerikanischen Bischofskonferenz, Dom Raymundo Assis aus Brasilien, ist das kein Widerspruch: "Der Schutz und die Unterstützung der Menschen in Armut ist ein zentraler Kernpunkt des christlichen Handelns", sagte der formell mächtigste Mann der katholischen Kirche in Lateinamerika zu stern.de.
In der Realität sieht das allerdings anders aus: Die sozialistischen Regierungen führen den Kampf der Befreiungstheologen auf anderer Ebene weiter und stoßen dabei auf erbitterten Widerstand der konservativen Kirchenkräfte. Während Lugo einen gemäßigten Kurs der Veränderungen führt, gehen Hugo Chavez in Venezuela und Rafael Correa in Ecuador mit den Idealen der Kirche weitaus weniger zimperlich um. Chavez leistet sich gar den Luxus einer eigenen von ihm finanzierten Glaubensgemeinschaft, die sich "reformierte katholische Kirche" nennt. Der katholische Erzbischof von Merida, Baltazar Porras, hat allerdings wenig Sympathie für die linientreuen Chavez-Jünger: "Mir fällt es schwer zu glauben, dass diese sogenannte reformierte Kirche tatsächlich eine "Kirche der Armen" ist, wie sie sich nennt, wenn ihre Veranstaltungen in Fünf-Sterne-Hotels stattfinden".
In Ecuador geht es wenige Wochen vor dem Referendum über die neue Verfassung noch ein Stückchen rauher zu. Staatspräsident Correa will die Rechte der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften stärken und das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankern. Deshalb geht die Kirche des Landes auf die Barrikaden. Offen rufen die ecuadorianischen Bischöfe die Gläubigen auf, am 28. September im "Sinne eines christlichen Bewusstseins" abzustimmen. Correa fürchtet das Votum der Bischöfe nicht umsonst: Ecuador ist ein tiefkatholisches Land. Als der Staatspräsident den Bischöfen vor wenigen Tagen gar "Verrat" vorwarf und vorhielt, die "Kirche stehe auf der Seite der Reichen", trudelten angesichts des vergifteten Klimas beim Vorsitzenden der ecuadorianischen Bischofskonferenz, Erzbischof Antonio Arregui, die ersten Morddrohungen ein. Erinnerungen an die Zeit, als führende lateinamerikanische Bischöfe oder Kardinäle ihre Überzeugung mit dem Leben bezahlten, werden wach. Diesmal kommt die Bedrohung allerdings nicht von ultrarechten Militärdiktaturen, sondern von linksradikalen Kirchenkritikern.