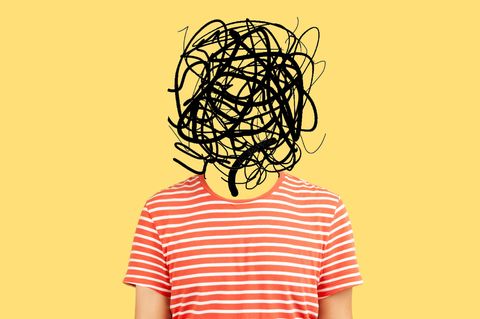Zum ersten Mal steigt ein Lateinamerikaner auf den "Thron" der globalen Handelsdiplomatie. Die Entscheidung für den Brasilianer Roberto Azevêdo als neuem Generaldirektor der Welthandelsorganisation (WTO) wurde von starken Schwellenländern durchgesetzt. Einmal mehr macht sie deutlich, dass die Dominanz der Industriestaaten in der Weltwirtschaft sich dem Ende zuneigt.
Der Westen musste nicht allein akzeptieren, dass der neue WTO-Chef aus jenem Teil der Welt kommt, von dem heute die größeren Hoffnungen auf Wachstumsimpulse zur Überwindung der Krise ausgehen. Den USA und der EU gelang es hinter den Genfer Kulissen nicht, den als eher wirtschaftsliberal und westlich orientierten Kandidaten Mexikos durchzusetzen, den Ex-Handelsminister Herminio Blanco, 62.
Doch die Industriestaaten werden sich mit Azevêdo, 55, arrangieren. Zumal es seitens der EU stets hieß, die Unterstützung Blancos sei kein Versuch, Azevêdo zu verhindern. Der langjährige Leiter Chef der WTO-Mission Brasiliens in Genf mag als US-kritisch in Einzelfragen gelten. Vor allem aber ist er als Insider mit Talent zur Streitschlichtung bei Wirtschaftskonflikten bekannt - und damit einer der wichtigsten Aufgaben der globalen Organisation.
Azevêdo steht vor einer Herkulesaufgabe
Als WTO-Chef, so hatte Azevêdo versprochen, werde er unparteiisch die Interessen der Organisation mit all ihren 159 Mitgliedsstaaten vertreten. Dafür sicherten ihm die USA als eines der ersten Länder Unterstützung zu. "Wir brauchen die WTO dringender denn je", sagte Thomas J. Donohue, der Präsident der US-Handelskammer. "Die Organisation steht an einem Scheideweg", fügte er unter Hinweis auf die nächste Welthandelskonferenz im Dezember in Bali hinzu.
Die Herkulesaufgabe, vor der Azevêdo mit seiner Amtsübernahme von Vorgänger Pascal Lamy, 67, zum 1. September steht, lässt sich kurz so beschreiben: Er soll die internationale Handelsdiplomatie "Von Doha nach Bali" führen. Doha steht für das bisherige Scheitern der WTO, Bali für die Hoffnung auf einen erfolgreichen Neustart.
In Doha nahmen WTO-Staaten 2001 Kurs auf eine "Entwicklungsagenda" zur Liberalisierung des Welthandels. Doch im Interessenkampf zwischen Industrie- und Entwicklungsländern erwies sie sich das Vorhaben als viel zu ehrgeizig und komplex. Damit sollte - bei gleichzeitiger Förderung der ärmsten Länder - das Volumen der globalen Ex- und Importe um etliche Milliarden US-Dollar ausgeweitet werden.
Vielen Länder setzen auf regionale statt globale Lösungen
Der Plan blieb im Wunschraumstadium stecken. Immer mehr Regierungen suchen ihr Heil längst in bilateralen oder regionalen Abmachungen statt auf einen Durchbruch zu einem globalen Abbau von Handelshemmnissen zu warten. Zudem greifen Staaten wieder verstärkt zu protektionistischen Maßnahmen. Die Relevanz der WTO wird dadurch immer mehr infrage gestellt.
Als Insider weiß Azevêdo, dass das Doha-Scheitern neben divergierenden Staateninteressen mit Struktur-Problemen der WTO zusammenhängt. Obwohl sie inzwischen 159 Mitglieder hat, können Entscheidungen nur im Konsens gefällt werden - jeder kann jedes Projekt blockieren. Auch für die Doha-Agenda gilt "Alles oder nichts": Keine Vereinbarung tritt in Kraft, ehe nicht alle Vorhaben einer Verhandlungsrunde beschlussfähig sind. Auch Lamys Nachfolger muss versuchen, diesen Teufelskreis zu überwinden.
Und mehr noch: "Für den neuen Generaldirektor muss es das Ziel sein, das Patt zwischen den großen Handelsblöcken USA und der Europäischen Union sowie China, Indien und Brasilien zu durchbrechen und den Doha-Motor wieder zu starten", wie der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, erklärte.
WTO-Ministerkonferenz als Feuerprobe
So wird die 9. WTO-Ministerkonferenz für Azevêdo zur "Feuerpobe". Mit dem Blick auf Bali erörtern Handelsdiplomaten in Genf seit einiger Zeit eine Abkehr vom Doha-Ansatz des "großen Wurfs" hin zu einem schrittweisen Vorgehen. In Bali sollen Handels- und Wirtschaftsminister sich auf relativ rasch anwendbare Beschlüsse auf einzelnen Gebieten verständigen.
Dazu gehört ein Bündel von Vereinfachungen bei Zollformalitäten. Gemessen an der Doha-Vision erscheint das geringfügig. Doch nach Berechnungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) könnten solche Erleichterungen im Warenaustausch die Handelskosten in Industriestaaten um 10 Prozent und in Entwicklungsländern um bis 16 Prozent reduzieren - und damit etliche Milliarden Dollar einsparen.
Für dieses Projekt muss Azevêdo etliche Entwicklungsländer gewinnen, wenn er Erfolge vorweisen will. Denn ohne die wachsende Handelsmacht der "Dritten Welt" geht in der WTO nichts mehr. Laut Welthandelsbericht für 2013 wird für die Industriestaaten ein Wachstum der Exporte von 1,5 Prozent erwartet, für die Entwicklungs- und Schwellenländer hingegen 5,3 Prozent. Ähnlich sieht es bei den Importen aus. Damit wird der Anteil dieser Staaten am globalen Handel auf mehr als 50 Prozent steigen.