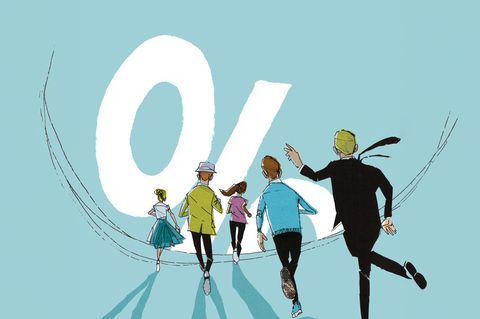Griechenland bekommt kein Geld mehr, zumindest vorerst - und kommt damit der Staatspleite immer näher. Nicht zum ersten Mal, das Land war in seiner jüngeren Geschichte bereits fünfmal bankrott. Wie viele andere Staaten übrigens auch. Deutschland etwa konnte sogar schon achtmal seine Rechnungen nicht mehr zahlen. Was im Fall eines Konkurses passiert, welche unguten Mechanismen greifen und wie hart die Konsequenzen für die Bewohner sind, lässt gut sich an der letzten großen Staatspleite ablesen, am Fall Argentinien.
Fast sieben Jahre lang hielt die existenzbedrohende Krise das Land in Atem. Begonnen hatte sie 1998, unrühmlicher Höhepunkt war der vollständige Kollaps des Finanzsystems Ende 2001. Wie Griechenland auch hatte Argentinien jahrzehntelang über seine Verhältnisse gelebt. Angehäuft wurden die Schuldenberge vor allem während der Militärdiktatur (1976-1983), als die Junta die Rüstungsausgaben rasant steigerte. In den 90er Jahren wurden erneut enorme Schulden gemacht, als Argentinien ein Programm zum Kampf gegen die Inflation auflegte. Zwar wurde die Hyperinflation, unter der das Land 40 Jahre lang litt, erfolgreich eingedämmt, dafür war das Land 1999 schließlich hoffnungslos verschuldet.
Staaten, die fünfmal oder öfter bankrott waren
Russland (fünf Pleiten, zuletzt 1998)
Nigeria (fünf Pleiten seit 1960)
Türkei (sechs Pleiten, die erste 1876)
Kolumbien (sieben Pleiten, zuletzt 1935)
Argentinien (sieben Pleiten, zuletzt 2014)
Österreich (sieben Pleiten, alle nach Kriegen und Besatzungen)
Frankreich (acht Pleiten, zuletzt 1812
Deutschland (acht Pleiten, zuletzt vor Beginn des Zweiten Weltkriegs)
Mexiko (acht Pleiten seit 1821)
Brasilien (neun Pleiten seit 1822)
Chile (neun Pleiten, zuletzt 1983)
Venezuela (zehn Pleiten, zuletzt 2004)
Ecuador (zehn Pleiten, zuletzt 2008)
Spanien (13 Pleiten seit 1476)
Plünderungen und Unruhen
Um den Forderungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) nachzukommen, beschloss die Regierung Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen. Es folgten Generalstreiks, in weniger als drei Monaten hoben die Bürger 22 Milliarden Dollar ab. Wie bei einem solchen Bankenrun üblich, führte die Regierung Kapitalverkehrskontrollen, was verhindern sollte, dass die Banken erst leergeräumt werden und danach zusammenbrechen. 90 Tage lang konnten die Menschen anschließend nicht mehr als 250 Pesos (damals 250 Dollar) pro Tag abheben. Doch die Einschränkung von Geldtransfers führten in dem südamerikanischen Staat schnell zu Plünderungen, Unruhen und der blutigen Niederschlagung der Proteste.
Am 19. Dezember 2001 rief Präsident Fernando de la Rúa einen Belagerungszustand aus. Einen Tag später, als sich tausende Demonstranten vor dem Präsidentenpalast versammelten, trat er zurück und floh per Hubschrauber. Am 23. Dezember kündigte Übergangspräsident Adolfo Rodríguez Saá ein Moratorium für Rückzahlungen der bei knapp 100 Milliarden Dollar liegenden Schuldenlast an.
70 Prozent des Werts war futsch
Doch der Krise hielt kein Staatschef lange stand: Das höchste Staatsamt wurde während zwei Wochen von einem Politiker zum nächsten gereicht. Als sich die Unruhen langsam legten, war die Wirtschaft um ein Fünftel geschrumpft, die Inflation in die Höhe geschnellt, der Peso um 70 Prozent abgewertet. Zwar kehrte Argentinien Ende 2002 in einem schmerzhaften Prozess zu Wachstum zurück, doch die Nachwehen währten länger. Zweimal konnte sich das Land mit den meisten seiner Gläubiger auf eine Umschuldung einigen, doch die Investoren mussten dabei bis zu 70 Prozent des Wertes ihrer Anleihen abschreiben.
Doch damit war die Lage noch immer nicht beruhigt, denn zwei US-Hedgefonds, die argentinische Schuldscheine nach der Staatspleite billig aufgekauft hatten, verlangen bis heute den vollen Wert ihres Investments zurück. Ein Urteil eines US-Gerichts bestätigt ihre milliardenschweren Forderungen, weswegen andere Zahlungen an internationale Gläubiger gestoppt wurden und Argentinien im Juli vergangenen Jahres erneut in einer Staatspleite rutschte.
Argentinien ist noch immer vom internationalen Kapitalmarkt ausgeschlossen. "Wir begnügen uns mit den Möglichkeiten, die wir haben", sagt Aldo Ferrer, der Ökonom hinter dem sogenannten Phönix-Plan zur Ankurbelung der Wirtschaft des Landes. Tatsächlich folgte auf die Krise ein Jahrzehnt mit Wachstumsraten von durchschnittlich acht Prozent jährlich, wobei das Land vor allem von Landwirtschaftsexporten profitierte. Mit Ausnahme Uruguays, das enge Handelsbeziehungen zu Argentinien unterhält, waren die Auswirkungen des Staatsbankrotts für die Nachbarn Argentiniens relativ überschaubar.