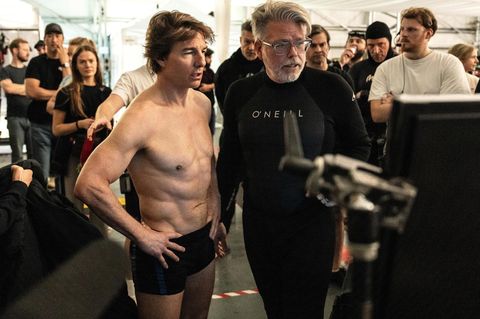Eigentlich sollte sich Mark Freeman zu den glücklichsten Menschen der Welt zählen. Der 52-Jährige lebt mit seiner Familie in seinem eigenen Haus, in einer von Bäumen gesäumten Straße, irgendwo im Herzen des reichsten Landes der Welt.
Wenn Mark Hunger hat, isst er. Wenn ihm heiß ist, schaltet er die Klimaanlage ein. Und wenn er etwas wissen will, surft er im Internet. Einmal pro Woche geht Mark zu einem Karaokeabend, und wenn er dort ist, singt er am liebsten "Man in Black" von Johnny Cash. Trotzdem stimmt seit einiger Zeit etwas nicht mit Marks Leben, es fühlt sich nicht mehr so gut an wie früher. Im vergangenen Jahr wollte die Bank den Freemans das Haus wegnehmen, nur weil sie drei Monate mit den Raten im Verzug waren. Andy, der Sohn von Mark, wurde vor Kurzem aus der Krankenversicherung geworfen, bis dahin war er bei seiner Mutter mitversichert. Für viel Geld musste er sich wieder zurückkaufen.
Und dann sind da noch die Drogenhändler und Schießereien im Viertel. Früher, da waren sie weit weg, jetzt scheinen sie immer näher zu kommen, manchmal sind sie nur ein Block entfernt. Das passt zur Kulisse der ganzen zugenagelten Häuser, die von Amerikas Epidemie erzählen. Der Epidemie der Zwangsvollstreckung.
Dieser Artikel...
ist erschienen in der Financial Times Deutschland
Das ganz normale Amerika
Das Beunruhigendste an den Freemans aber ist, dass sie eine durchschnittliche amerikanische Familie sind. Keiner ist chronisch krank, weder der hagere Mark noch die rundliche Connie, seine Frau. Beide haben Arbeit, am Methodisten-Krankenhaus, er in der Warenannahme, sie ist technische Assistentin in der Anästhesie. Zusammen verdienen sie 70.000 Dollar, damit ist ihr Gehalt um ein Drittel höher als das Durchschnittseinkommen eines US-Haushalts.
Es gab eine Zeit, da hat man das Leben von Mark und Connie Freeman als "amerikanischen Traum" bezeichnet. Aus dem Traum ist längst eine unruhige Träumerei geworden. Denn das Leben der Freemans ist inzwischen sehr anstrengend. Jeden Monat muss Mark viel Geld bezahlen, um eine Maschine zu mieten, die seine Atemnot lindern soll. Deswegen leidet er auch an Schlafstörungen. "Wenn wir unsere Jobs verlieren, werden unsere Ersparnisse etwa drei Wochen reichen. Dann wäre die Schmerzgrenze erreicht", sagt Mark.
Er sitzt auf der Veranda, trinkt eine Flasche Miller Lite und schaut auf die Straße. "Wir arbeiten Tag und Nacht und versuchen, etwas fürs Alter zurückzulegen. Aber unser Polster sind immer nur ein, zwei Gehaltschecks, dann sitzen wir auf der Straße."
Die heile Welt der oberen zehn Prozent
Wenn man von der amerikanischen Mittelklasse spricht, haben die meisten Ausländer Klischees vor Augen. Diese Bilder sind zeitlos und geleckt, Bilder aus US-Serien wie "The Brady Bunch" oder "Desperate Housewives", in denen Teenager in Sportwagen zur Schule fahren und die Mädchen Cheerleader sind. In dieser heilen Welt leben vielleicht die oberen zehn Prozent. Der Rest lebt wie die Freemans. Oder noch schlechter. Es dauert nur 30 Sekunden, um Marks Haus zu besichtigen, das im Nordwesten von Minneapolis liegt. Es ist vollgestopft mit kitschigem Zeug, 1989 hat er es mit einer Hypothek in Höhe von 50.000 Dollar gekauft. Jetzt ist es 73.000 Dollar wert.
"Es gab einen Zeitpunkt, da war es 105.000 Dollar wert. Wir dachten, wir hätten das Nirwana erreicht", sagt Mark. "Immer wieder riefen Leute von der Bank an, manchmal vier-, fünfmal pro Abend, um uns neue Darlehen oder Kredite für Renovierungen anzudrehen. Die waren wie Drogendealer." Wenn die Freemans sprechen, hört man weder Hoffnung noch Aufbruch. Die Zukunft kommt, und sie wird ertragen. Am Kühlschrank hängen einige dieser Magnetschilder, auf denen Sprüche stehen. "Ich würde dir gern sagen: Fahr zur Hölle. Aber dort arbeite ich, und ich will dich nicht jeden Tag sehen." Mark kichert: "Lachen ist die beste Medizin." Es ist, als würde ihnen jemand eine Schlinge um den Hals zuziehen. Der Abstieg der Freemans und Millionen anderer Amerikaner begann schleichend, schon lange vor der Rezession. Diese hat alles nur verschlimmert, denn seit Langem leiden viele Amerikaner an einer "persönlichen Rezession".
Ökonomen bezeichnen das als "Median Wage Stagnation". Das durchschnittliche Jahreseinkommen der unteren 90 Prozent hat sich seit 1973 kaum verändert - in den vergangenen 37 Jahren ist es real um nur zehn Prozent gestiegen. Die meisten Amerikaner treten also seit mehr als einer Generation auf der Stelle. Im gleichen Zeitraum haben sich die Einkommen des obersten Prozents verdreifacht. 1973 erhielten Vorstandschefs das 26-Fache des Durchschnittslohns, inzwischen ist es das 300-Fache.
Völlig untypisches Phänomen
Viele Ökonomen sehen in dieser Stagnation ein strukturelles Problem - unabhängig von der Konjunktur. Im letzten Aufschwung, zwischen Januar 2002 und Dezember 2007, sank das mittlere Haushaltseinkommen um 2000 Dollar. Es war das erste Mal, dass es den meisten Amerikanern am Ende eines Aufschwungs schlechter ging als zu Beginn. Parallel dazu gibt es ein für die USA völlig untypisches Phänomen: die Chancen, in eine höhere Einkommensschicht aufzusteigen, sind gesunken.
Alexis de Tocqueville, der große französische Chronist des frühen Amerika, wurde einst zitiert mit dem Spruch: "Amerika ist das beste Land der Welt, um arm zu sein." Das ist längst nicht mehr der Fall. Heutzutage hat man in den USA eine geringere Chance, von einer niedrigen in eine höhere Einkommensgruppe zu wechseln, als in fast jedem anderen Industriestaat.
Der Schriftsteller Horation Alger hat im 19. Jahrhundert in Hunderten von Geschichten erzählt, wie junge Männer aus der Unterschicht es schafften, durch harte Arbeit, Mut und Einsatz für andere den "amerikanischen Traum" zu leben. Heute müssten diese Geschichten wohl anders erzählt werden, denn wer heute in Lumpen geboren wird, wird weiter Lumpen tragen.
Ein ungemütliches Wohnhaus
Hinzu kommt die starke Ungleichheit der Gesellschaft - und deshalb schwelt diese Krise des amerikanischen Kapitalismus. Es ist schon hart für viele Amerikaner, dass ihre Löhne stagnieren. Noch härter aber ist es, dass es immer schwerer wird, an dieser Situation etwas zu ändern. "Who killed the American Dream?", steht auf den Bannern der Protestmärsche der Linken. "Gebt uns Amerika zurück", rufen die Tea-Party-Demonstranten auf der Rechten.
Die Daten zeigen aber nur einen Teil der sozialen Spannungen. Der berühmte Harvard-Ökonom Larry Katz benutzt einen prägnanten Vergleich: "Man muss sich die amerikanische Wirtschaft wie ein großes Wohnhaus vorstellen. Vor einem Jahrhundert, und sogar noch vor 30 Jahren, wollte alle Welt darin wohnen. Aber im Laufe der letzten Generation hat sich das Haus verändert. Die Penthouse-Wohnungen ganz oben werden immer größer und größer. Die Apartments in der Mitte fühlen sich immer enger an. Das Untergeschoss ist bereits überflutet. Und dann ist auch noch der Fahrstuhl kaputt - das deprimiert die Leuten am meisten."
In Amerika stirbt die Hoffnung. Eine wachsende Mehrheit fürchtet, dass es ihren Kindern künftig schlechter gehen wird als ihnen. Die ersten drei Jahrzehnte nach dem Krieg waren im Rückblick eine goldene Ära. Damals galt die Losung von John F. Kennedy, dass "ein steigendes Wasser alle Boote hebt". Die Realeinkommen stiegen um fast zwei Prozent pro Jahr, verdoppelten sich mit jeder Generation. Man musste noch nicht mal studiert haben, um über die Runden zu kommen. Trotzdem erhielt die Masse damals Zugang zu höherer Bildung.
Der typische Bandarbeiter in Detroit
Connie Freeman ist in einem klassischen Arbeiterhaushalt in der Bergbauregion im Norden Minnesotas nahe der kanadischen Grenze aufgewachsen. Diese wird hier nur die "The Iron Range" genannt. Ihr Vater, der mitten in der Großen Depression der 30er-Jahre aufwuchs, ging zur Schule, bis er 14 war, dann arbeitete er sein ganzes Leben in den Eisenminen. Am Ende verdiente er 15 Dollar in der Stunde, heute wären das umgerechnet 40 Dollar.
30 Jahre später verdient Connie 17 Dollar die Stunde, obwohl sie weit besser ausgebildet ist, als ihr Vater es jemals war. Auch das Tempo ihres Lebens hat sich verändert. "Als ich aufgewachsen bin, saßen wir jeden Tag zusammen beim Abendbrot", erzählt Connie. Sie dehnt die Vokale, es ist der Ton des Mittleren Westens. "Heutzutage ist so etwas soooo selten."
Ihr Vater verdiente genug, damit ihre Mutter zu Hause bleiben konnte. Trotzdem reichte es, zwei Kinder durchs College zu bringen. Connie und Mark müssen sich dagegen schon abrackern, um alle Rechnungen in ihrem Doppelverdienerhaushalt bezahlen zu können. Das Theaterstudium am örtlichen College für den autistischen Sohn Andy bezahlt der Staat Minnesota.
Streng genommen hat die Familie sogar vier Einkommen. "Als Andy zwei war, wurde uns geraten, eine Karaokemaschine zu kaufen. Das soll autistischen Kindern guttun", erzählt Mark und zeigt auf einen alten Kasten. "So bin ich ins Karaokegeschäft gekommen. Jeden Mittwochabend verdiene ich damit 100 Dollar. Und samstags helfe ich in einem Spirituosenladen aus. Wir brauchen alle vier Jobs, um über Wasser zu bleiben." So viel zu Kennedys steigender Flut.
Bis hierher ist die Geschichte unstrittig. Die meisten Ökonomen stimmen mit der Diagnose überein. Nur über die Ursachen sind sie sich uneinig. Bei den Linken machen viele die Globalisierung verantwortlich. Der Aufstieg von Ländern wie China, Indien und Brasilien habe die Löhne im Westen unter Druck gesetzt. Amerikas ungebildete, halbgebildete und sogar gebildete Arbeiter wurden aus ihren Jobs gedrängt.
Nur noch zwei Prozent der Arbeitsplätze sind heute in der Industrie. Vor 30 Jahren noch hatte der typische Bandarbeiter in Detroit ein sicheres Leben. Er hatte eine gute Krankenversorgung und konnte mit einer üppigen Pension rechnen. Heute lebt dieser Typ Mensch in Shenzhen.
Rund um Washington D.C.
Eine andere Gruppe von Experten macht für den Niedergang den Siegeszug neuer Technologien verantwortlich, durch den einfache Arbeitsplätze durch Computer ersetzt wurden. Man denke nur an die Sekretärin, die einst das Diktat aufnahm und Kaffee kochte. Heute hat man einen Blackberry und verbringt das halbe Leben bei Starbucks. Und irgendein Mensch in Bangalore heftet die Rechnungen ab, während man schläft.
Dann gibt es Leute wie Paul Krugman, den Ökonomen und Nobelpreisträger, der die Politik für die Misere verantwortlich macht. Vor allem die konservative Revolution, die mit Ronald Reagan 1980 begann. Sie beschleunigte den Niedergang der Gewerkschaften und schaffte die fortschrittlichsten Elemente des US-Steuersystems wieder ab.
Heute gehören weniger als ein Zehntel der Beschäftigten einer Gewerkschaft an. Mehr als die Hälfte der Privatinsolvenzen haben als Ursache eine Krankheit oder Unfälle, also eine teure Krankenversicherung. Ganz anders in Europa oder Kanada: Dort sind die Menschen zwar den gleichen Kräften der Globalisierung ausgeliefert. Sie sind aber in der Gewerkschaft, und ihre Gesundheitsversorgung ist meist staatlich organisiert.
Das sind die verschiedenen - nicht unbedingt gegensätzlichen - Theorien über die Ursachen. Dazu kommt die "gelebte Erfahrung", wie Soziologen sagen. Ähnlich wie den Freemans geht es Millionen anderen Familien. Zum Beispiel den Millers, die woanders in den USA leben. Die drückende Hitze verrät, dass man in Virginia ist, also im Süden.
Falls Church, ein Vorort von Washington, ist eine jener Regierungsvorstädte, die davon profitiert haben, dass sich die Regierung immer mehr ausbreitet. Es gibt viele Unternehmen hier, die gut laufen, weil sie vor allem mit Sicherheit oder Lobbyarbeit ihr Geld verdienen. Im Haus der Millers steht ein unscharfes Foto, es zeigt Shareen mit Barack Obama bei einer Feier im Weißen Haus.
Shareen, 42, organisiert Virginias 8000 Pflegeassistenten, die sich um Alte und Schwache in deren Häusern kümmern. Seit einiger Zeit sinkt Shareens Einkommen. Im letzten Jahr waren es noch 1500 Dollar pro Monat, jetzt sind es nur noch 900 Dollar. Auch Virginia muss sparen.
Obwohl des Haus der Millers doppelt so groß ist wie das der Freemans, wirkt es eng. Neben Shareen wohnen hier ihr Mann, ihre zwei Söhne, eine Schwiegertochter, ein Enkel und einige Haustiere. Außerdem ist Marissa oft bei ihnen, eine 26-jährige Frau, die im Rollstuhl sitzt und von ihr gepflegt wird.
"Raten Sie mal, wem ich ähnlich bin?"
Shareen hat diesen typischen amerikanischen Goodwill. Obwohl sie kaum Zeit hat, arbeitet sie samstags freiwillig für die Wohlfahrtsorganisation Lost Pets. Wenn die Millers die Straße runterfahren, kommt bald die Kreuzung mit einem Taco Bell, dem Supermarkt 7-Eleven, einem Ein-Dollar-Shop und einem dieser Läden, in denen man für hohe Gebühren kurzfristig Bargeld besorgen kann. Diese breiteten sich zuletzt immer mehr aus.
Shareens Vater arbeitete früher im Staatsgefängnis von Oregon, sie hat mehrere Halbgeschwister, die alle kaum über die Runden kommen. "Raten Sie mal, wem ich ähnlich bin", fragt sie. "Keinem von denen." Ja, denn eigentlich geht es auch Shareen Miller gut. Ihr Mann arbeitet für eine Feuersicherheitsfirma und verdient 70.000 Dollar. Die Millers werden also überleben.
Aber sie fürchten sich davor, dass einer von ihnen krank werden könnte. Vor ein paar Jahren wurde Shareen ein Tumor aus dem Zwerchfell entfernt, was ihr 17.000 Dollar Schulden einbrachte. Und ihr Ehemann Mark leidet an einem Bandscheibenvorfall. Shareen musste eine Zahnoperation sechs Monate verschieben, um erst ihren Autokredit weiter abbezahlen zu können. Dabei ist das gemeinsame Einkommen doppelt so hoch wie das US-Durchschnittseinkommen.
Zeit, sich weiterzubilden, bleibt auch keine. "Das ist typisch für Leute aus dem Sozialsektor", sagt sie. "Wir haben nie Zeit."
So, wie die Ökonomen über die Ursachen der großen Stagnation streiten, streiten sie über mögliche Auswege. Die meisten glauben, dass die Bildung besser werden muss, auch wenn sie nicht die Wurzel des Problems ist. Andere stellen nur fest, dass eben nicht jeder ein Investmentbanker, ein Softwareentwickler oder ein Harvard-Professor sein kann.
Viele der künftigen Arbeitsplätze werden dort entstehen, wo Menschen mit Menschen zu tun haben - denn die können weder von Computern noch von Indern ersetzt werden: Hausmeister etwa, Krankenpfleger oder Gärtner, Jobs, für die ein College überflüssig ist. Schon im Laufe des letzten Jahrzehnts wurde eine große Masse der Absolventen von der Stagnation erfasst - auch künftig wird sie nicht immun sein. Eine bessere Bildung wird die Chancen des Einzelnen erhöhen. Wer das bezahlen soll, ist eine andere Frage.
Shareen war immer unpolitisch
Shareens Sohn Dustin und ihre Schwiegertochter Ruth, beide 23, sind gerade wieder bei ihr eingezogen. Sie konnten sich die Miete nicht leisten - obwohl beide einfache Jobs haben. Dustin arbeitet für eine Renovierungsfirma, Ruth in einem Kleidungsgeschäft. Beide waren eigentlich gut in der Highschool, sie wollten Meeresbiologie studieren - ein Beruf mit Zukunft. Aber sie konnten sich die Studienkredite nicht leisten. Während nämlich die Einkommen stagnieren, steigen die Kosten für die Ausbildung.
Seit 1990 hat sich der Anteil der Amerikaner, die zehn Jahre nach ihrem Abschluss noch mehr als 20.000 Dollar von ihren Studienkrediten abbezahlen müssen, verdoppelt. Barack Obamas Wirtschaftsberater Lawrence Summers, der sich oft über die "ängstliche Mitte" aufgeregt hat, weist auf ein anderes Problem hin: Die USA haben zwar unter den großen Wirtschaftsnationen den höchsten Anteil Hochgebildeter unter den Erwerbstätigen. In der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen aber sind sie nicht mal unter den Top Ten.
Immer mehr junge Amerikaner schrecken die Kosten ab. "Es geht nicht nur um die Schulden - es geht auch um die vier Jahre ohne Einkommen", sagt Ruth. Shareen kann das nicht verstehen. Shareen war immer unpolitisch. Aber es gab einen besonderen Moment in ihrem Leben: Vor drei Jahren wurde sie von Mark Warner angesprochen, einem demokratischen Senator aus Virginia. Er wollte sie "für einen Tag vertreten". Das Engagement war Teil seiner Wahlkampagne.
Nachdem er erlebt hatte, wie hart Shareens Arbeit war, kaufte Warner ihr für 6000 Dollar einen Außenlift, womit sie Marissa auf die Veranda fahren kann. "Was für ein wunderbarer Mann", sagt Shareen. "Ich würde ihn gern noch einmal treffen."
Ratlose Regierung
Die Demokraten haben bislang jedoch kaum etwas getan, um die große Stagnation zu bekämpfen. Während seines Wahlkampfs hat Obama oft über die langen Jahre der Stagnation gesprochen. Er versprach, die Situation zu ändern. Und ja, seine Regierung hat einiges getan: So hat sie die Budgets für die kommunalen Colleges erhöht und ein 5 Milliarden Dollar schweres Programm aufgelegt, mit dem die Bundesstaaten ihre Schulen verbessern sollen. Aber selbst das Weiße Haus wurde von der Wucht der Krise überrascht.
Die Folgen für Leute wie die Millers oder die Freemans waren heftig. Erst kam die Stagnation. Dann die Rezession. "Es ist, als ob man immerzu das Wasser aus einem sinkenden Boot schöpft - und dann nehmen sie dir einfach deinen Eimer weg", sagt Mark Freeman. Die Banken rufen nicht mehr an. Nun kommen die Gerichtsvollzieher.
"Einen Tag kriechen dir die Banken in den Arsch, und am nächsten Tag hassen sie deinen Darm", sagt Freeman. Nur mithilfe eines befreundeten Anwalts konnte er die Zwangsräumung verhindern. Die Bank of America, die Ende 2008 mit mehr als 45 Milliarden Dollar Steuergeld gerettet wurde, hatte gleich mehrfach die Papiere der Freemans verschlampt. "Ich vermute, die Bank wollte die Hypothek vollstrecken, weil wir so kurz davor waren, sie abzubezahlen", sagt Freeman. "Das wäre für sie profitabler gewesen." Am Ende konnten die Freemans aber überzeugend darlegen, dass sie weiter die Raten zahlen. Mark hat ausgerechnet, dass sie 163.000 Dollar für das Haus gezahlt haben, das sie einst zum Drittel des Werts erworben haben. Es könnte alles umsonst gewesen sein.
Was ist die Zukunft des amerikanischen Traums? Michael Spence, Nobelpreisträger der Ökonomie, der für die Weltbank eine Studie über die Zukunft des globalen Wachstums verfasst hat, hat eine düstere Vorahnung. Spence sieht die große Stagnation vor dem Hintergrund einer tiefen Identitätskrise der USA.
Über Jahre wurde dieses Problem versteckt oder abgefedert durch die Möglichkeit, sich billig zu verschulden. Die Mittelklasse wurde geradezu ermutigt, sich zu verschulden, Hypotheken aufs Haus aufzunehmen oder die Altersvorsorge anzuzapfen. All das geschah im Glauben, dass die Häuserpreise und die Aktienmärkte endlos steigen würden.
Eine Sicht freilich, die die Hälfte aller Ökonomienobelpreisträger geteilt hat - Spence nicht eingeschlossen. Aus dem billigen Geld sind nun teure Schulden geworden. Die Generation der Babyboomer geht erst mal nicht in Rente. College-Absolventen ziehen wieder bei ihren Eltern ein.
"Ich habe ein ungutes Gefühl"
Der Gradmesser in den USA ist die Wirtschaft. Aber der Zorn ist immer noch menschlich und zunehmend politisch. "Ich habe ein ungutes Gefühl, was die Zukunft der USA angeht", sagt Spence. "Wenn die Menschen ihren Optimismus verlieren, werden die Dinge hier unbeständig und unberechenbar. "
Er fürchtet, dass Amerika "lateinamerikanischer" werden könnte. "Wir haben eine stark ungleiche Gesellschaft, die empfänglich ist für extreme Strömungen. Schwer vorstellbar, dass eine solche Gesellschaft vernünftig regiert werden kann. Nehmen wir die Tea-Party-Bewegung. Viele denken ja, die komme aus dem Nichts. Die meisten Anhänger sind Amerikaner aus der Mittelklasse, die jahrelang still vor sich hin gelitten hat."
Spence räumt ein, dass er mit seinen Ahnungen über das hinausgeht, was er als Ökonom an Daten hat. Und er glaubt, dass Amerika womöglich immer noch über seine dynamischen Kräfte verfügt, seine Weltklasse, technische Innovationen hervorzubringen. Die meiste Ökonomen sind auch nicht so düster in ihren Prognosen wie Spence.
Es sind aber die Viertel, in denen die Durchschnittsamerikaner wohnen, wo sein Pessismismus am lautesten Widerhall findet. "Es ist so neu für die Amerikaner, pessimistisch zu sein. Ja es ist absolut unamerikanisch" , sagt Spence. "Aber die meisten Menschen schätzen ihre Lage besser ein als die Ökonomen."
Ab und zu laden die Freemans ihre Nachbarn zu sich auf die Veranda ein. Sie trinken Bier und essen ein Wildreis-Gericht, für das Connie zu Recht berühmt ist. In bester amerikanischer Tradition sind Mark und Connie wirklich gute Nachbarn. Sie schaufeln Schnee vor anderen Häusern und trainieren den Nachwuchs der Baseballmannschaft.
Um so zu sein, braucht es Optimismus. In den letzten paar Jahren haben die Freemans immer weniger von alldem gemacht. "Ich glaube, der Groschen ist in den letzten 18 Monaten gefallen. Als wir festgestellt haben, dass wir uns niemals auf unseren Ersparnissen werden ausruhen können", sagt Connie. "Wegen Andy habe ich Angst vor der Zukunft. Wenn man jung ist, ist es schon schwer genug. Aber für ein autistisches Kind?"
Was der "amerikanische Traum" für sie bedeutet? "Es ist kein Traum", sagt Mark, und sein Gesicht ist leer. "Ich hasse es zwar, so zu reden wie diese Tea-Party-Leute. Aber ich will nur eins: mein Land zurück. Ich glaube nur, dass das nicht passieren wird." Seine Worte erinnern an einen Witz von George Carlin: "Es heißt der amerikanische Traum, weil man schlafen muss, um daran zu glauben." Als Kind hat Andy Karaoke gesungen. Es habe wahre Wunder gewirkt, erzählen Mark und Connie. "Sie sollten Andy unten im Klub sehen, die Frauen schmelzen dahin", sagt Connie. "Er wird dann ein anderer Mensch."
Als Andy ins Zimmer kommt, singt er los, klar und ohne Fehler, einen alten Broadway-Schlager: "The Impossible Dream" aus dem Musical "Der Mann von La Mancha". "To dream the impossible dream / to fight the unbeatable foe / to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go."
Es war einer dieser Momente, die es nur in Amerika gibt.