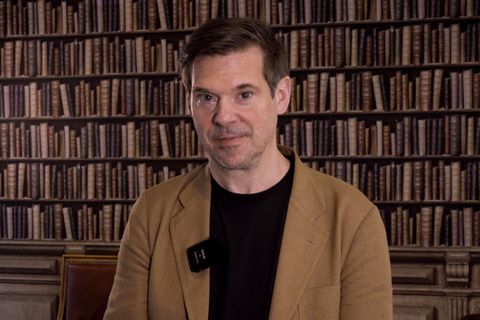Wenn Sie nichts zu verbergen haben, haben Sie nichts zu befürchten - seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ist das ein gern gebrauchter Satz. Damit sollen Bürger der westlichen Welt, die sich gegen die Freiheitsbeschneidung im mal mehr, mal weniger hysterischen "Krieg gegen den Terror" wehren, mundtot gemacht werden. Und viele haben sich tatsächlich abgefunden mit der ständig zunehmenden Kontrolle und Kontrollierbarkeit. Alles im Namen der zu verteidigenden Freiheit.
Fast zehn Jahre später taucht nun eine Organisation an die mediale Bewusstseinsoberfläche, die die Richtung dieser Worte umkehrt. Und das sorgt für eine ganz neue Hysterie.
Staatsfeind Nr. 1
Die Internetplattform Wikileaks und vor allem ihr Gründer, der Australier Julian Assange, stehen für ein neues Zeitalter der Aufklärung, der digitalen. Wikileaks stellt geheimgehaltene Studien, Dossiers, Videos, Protokolle ins Netz, in denen monströse Wahrheiten stecken. Sei es die gutgelaunte Jagd amerikanischer Soldaten auf irakische Zivilisten, massive Korruption in Kenia oder Kriegspläne im Nahen Osten. Die Quellen bleiben anonym, der Wahrheitsgehalt wird vor Veröffentlichung verifiziert. Noch nie war jenseits aller Verschwörungstheorien so deutlich, wie viel die Regierungen und mächtigen Organisationen dieser Welt - auch auf der "Achse des Guten" - zu verbergen haben.
Seit vier Jahren ist Wikileaks online. Spätestens seit der Veröffentlichung der "War Logs" aus Afghanistan und Irak (Geheimberichte über die "Dreckigkeit" der Kriege) im vergangenen Juli und Oktober ist Wikileaks-Aushängeschild Julian Assange im US-Feindbild-Ranking kurz davor, Osama Bin Laden zu überholen. Möchte-Gern-Präsidentin Sarah Palin forderte sogleich, den Australier "wie einen Terroristen zur Strecke zu bringen". Andere lösten "Tötungsfantasien" auf ihre Weise: Plattformen, derer sich Wikileaks zur Speicherung seiner Datenmassen bediente, über die Spenden zum Erhalt der Organisation gesammelt wurden, über die Informanten ihr Material loswerden konnten, kündigten Wikileaks unter fadenscheinigen Gründen die Zusammenarbeit - darunter Amazon und Ebay. "Wir sind im Krieg", nennt es US-Senatorin Lindsey Graham, die Assanges Verurteilung fordert. Auch wenn man sich der Anklagepunkte noch nicht ganz sicher ist.
Ein neuer Krieg
Es ist tatsächlich ein neuer Krieg. Ein Krieg, dessen Ausmaße gerade erst sichtbar werden. Ein Krieg von Alt gegen Neu. Die gesetzten Strukturen und Machtverhältnisse wehren sich nicht nur gegen Kritiker und Zweifler, sie kämpfen gegen Veränderungen, die die digitale Öffentlichkeit bringt. Auch wenn längst klar ist, dass sie nicht aufzuhalten sind, es sei denn, man schaltet das gesamte Internet ab, wie es John Naughton im "Guardian" auf den Punkt brachte.
Wikileaks stellt nicht weniger als die Demokratie auf den Prüfstand, um diese dröge Formulierung zu bemühen. Noch Anfang des Jahres hatte US-Außenministerin Hillary Clinton die Freiheit der Information und des Internets beschworen. "Selbst in autoritären Staaten helfen Informations-Netzwerke den Menschen, neue Wahrheiten zu entdecken und Regierungen in die Verantwortung zu nehmen". Nach der Veröffentlichung von 250.000 Diplomaten-Depeschen klang das anders: "Diese Enthüllungen sind nicht nur ein Angriff auf die US-Außenpolitik, sie sind ein Angriff auf die internationale Gemeinschaft. (...) Wir werden aggressive Schritte unternehmen, um jene zur Rechenschaft zu ziehen, die diese Informationen gestohlen haben", so Clinton Ende November.
Mit "jene" ist natürlich Julian Assange gemeint, der derzeit in London in Untersuchungshaft sitzt und nach Schweden ausgeliefert werden soll, wo ihn eine umstrittene Anklage wegen sexueller Nötigung erwartet. Spätestens seit der Festnahme am Dienstagmorgen droht die Aufregung über Assanges persönliche Angelegenheiten das Anliegen von Wikileaks zu überschreien. Das wäre fatal, hätten dann doch die gewonnen, die Wikileaks offline sehen wollen.
"Was von den aufgebrachten Beamten unserer Demokratien zu hören ist, ist vor allem das bockige Geschrei von Kaisern, deren Kleider das Internet zerrissen hat", schreibt Simon Jenkins im "Guardian" über das Verdienst von Wikileaks. Eben diese Kaiser, die immer wieder sagen: "Wenn Sie nichts zu verbergen haben, haben Sie nichts zu befürchten."