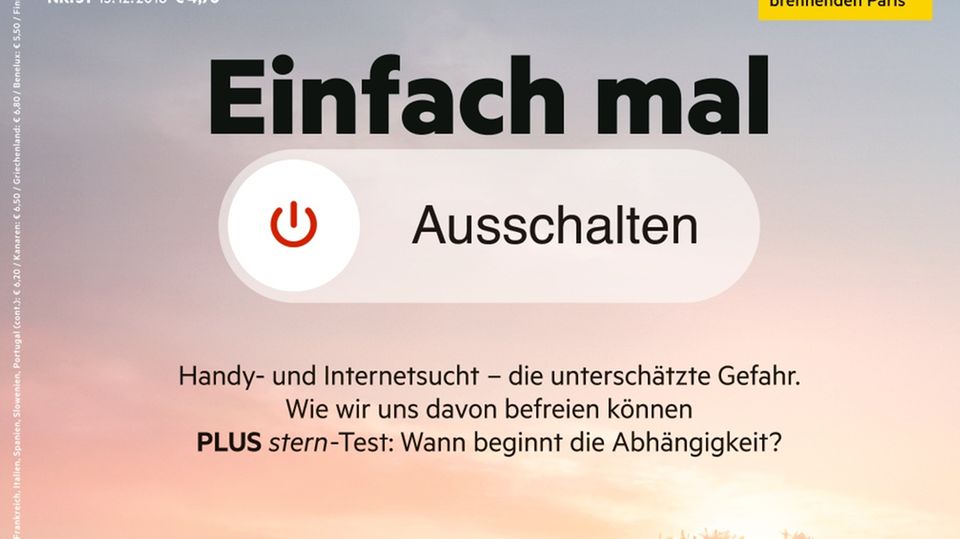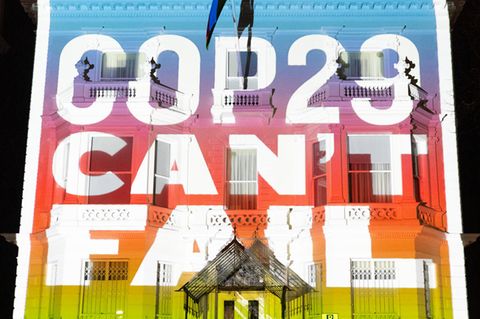Die Deutschen, das sind die Erfinder der Energiewende, ökologisch bewusst und dem Klima verpflichtet – so will die Bundesregierung bei der Weltausstellung 2020 in Dubai das Land präsentieren. Als Staranwalt der geschändeten Mutter Natur. Gerade wird in Köln ein 4600 Quadratmeter großer Öko-Pavillon für die Millionen Expo-Besucher entwickelt: der "Campus Germany". 50 Millionen Euro soll er kosten. Viel Geld – für eine Fata Morgana.
Denn in Wahrheit ist Deutschland längst kein grünes Vorbild mehr. Unter der "Klimakanzlerin" Merkel ist das Land zum Scheinriesen mutiert: Je näher man ihm kommt, desto kleiner wird er. In fast allen Sektoren des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes sind die Deutschen weit hinter die eigenen Ansprüche zurückgefallen. Unter den 28 EU-Staaten liegen sie beim Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 auf Platz 23. Weltweit verursachen sie den achtschlechtesten ökologischen Fußabdruck. Die Menschheit brauchte drei Erden, wenn alle so ungehemmt unökologisch leben würden wie wir, hat die Umweltorganisation Global Footprint Network errechnet.
Halle statt Himmel
Auf den ersten Blick ist dieser Befund kaum zu glauben: Die Bundesbürger trennen hingebungsvoll ihren Müll und errichten Windräder, Bauern stellen in Scharen auf ökologische Landwirtschaft um, Plastiktüten werden verbannt und Ameisenstaaten umgesiedelt, bevor eine Autobahn gebaut werden darf. Doch wer sich auf die Suche nach den ökologischen Fakten begibt, stößt auf tiefe Risse in der grünen Fassade – auf Menschen und Orte, die unter der Umwelt-Vergessenheit der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik schon heute leiden: unter schädigendem Lärm und krank machender Luft. Unter der Ausbeutung der Rohstoffe und der Zerstörung der Landschaft.
Ein Kirchlein aus Stein, zufrieden malmende Kühe, blitzblanke Höfe: Hebenshausen, ein Dorf südlich von Göttingen. Hier leben Silke und Matthias Schmidt mit ihren beiden Kindern in einem Einfamilienhaus. Im Erdgeschoss befindet sich ihr modern gestyltes Wohnzimmer mit einem Schaufenster in die wunderbare Natur. Sie bitten die Treppe hinauf ins Dachgeschoss, ein Schlagzeug unter dem Fenster, der Blick hinaus – auch hier: ein Traum. Vor dem Grundstück erstrecken sich saftige Äcker. "Allerbester Boden", sagt Matthias Schmidt. Dahinter: das Eichsfeld, eine mit Schlössern und Klöstern gespickte Landschaft. Silke Schmidt zeigt in die Ferne: "Wir können sogar die uralte Burg Hanstein sehen!"

"Noch", schiebt sie leise nach. Denn wenn kein Wunder geschieht, schauen die Schmidts bald auf eine 15 Meter hohe Wand.
Auf den Äckern vor ihrem Haus will ein Investor eines der größten Logistikzentren Europas hochziehen – so groß wie 115 Fußballfelder. Vor dem Häuschen der Schmidts steht dann eine gigantische Lagerhalle. Lkw-Gerumpel statt Vogelgezwitscher. Der Gemeinderat findet: Das muss! Es gehe um Arbeitsplätze und Steuereinnahmen für die Region. Die Schmidts finden: Das muss nicht! Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, der Gemeindehaushalt ziemlich ausgeglichen – und die Lagerhalle würde für immer das Land zerstören, das sie lieben. Seine Geschichte. Seine Kultur. Seine Schönheit.
Nicht nur in Hebenshausen – in ganz Deutschland wird seit Jahren die Natur Hektar um Hektar für Industriegebiete, Möbelcenter, Burgerbuden, Neubausiedlungen oder Straßen geopfert. Im Jahr 2002 hatte die rot-grüne Bundesregierung versprochen, den Raubbau bis 2010 von damals 130 auf 30 Hektar pro Tag zu senken. Doch bis heute verschwindet gut die doppelte Menge: etwa 66 Hektar am Tag. Das macht alle drei Tage einen Hambacher Forst. Binnen 25 Jahren sind so Landschaften von der vierfachen Größe des Saarlands zerstört worden.
Irreversible Folgen
Sicher, wenn die Wirtschaft wachsen soll, wenn die Deutschen immer häufiger online einkaufen, wird Bauland für Lagerhallen gebraucht. Aber anstatt, wie von der Politik längst zugesagt, dafür stillgelegte Industriestandorte, Bahnflächen oder ehemalige Militärstützpunkte zu nutzen, müssen weiter vor allem Naturlandschaften und Agrarflächen dran glauben.
Die Schmidts haben sich der "Bürgerinitiative für ein lebenswertes Neu-Eichenberg" angeschlossen. An vielen Häusern hängen Protesttransparente. Im Gasthaus "Waldmann" wird abends heftig gestritten. Auch über den Verlust von Vermögen. Der Mann von der Sparkasse hat den Schmidts gesagt: Mit dem Logistikzentrum bricht der Wert ihres Häuschens um ein Drittel ein. Dennoch stehen die Chancen, den Neubau zu verhindern, schlecht. Denn platzt der Deal mit dem Investor, muss die Kommune rund 1,2 Millionen Euro Planungskosten übernehmen. Das wollen die Verantwortlichen unbedingt verhindern.

Dabei kann auch die rücksichtslose Bebauung für die Kommunen schmerzhaft werden. Jana Bovet vom Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hat die irreversiblen Folgen des Flächenfraßes untersucht: Versiegelte Böden kühlen nicht in warmen Nächten und nehmen keinen Starkregen auf. Mögliche Folgen: Tropenhitze zur Schlafenszeit und Überschwemmungen auf Straßen und Plätzen. Außerdem müssten die Kommunen für den Anschluss der neu entstandenen Gewerbegebiete sorgen – mit Straßen oder Wasser- und Stromleitungen. "Oft übersteigen die Infrastrukturkosten die Steuereinnahmen bei Weitem", sagt die Umweltexpertin.
Zahlen, die lügen
In Neuburg an der Donau steht Martin Schubert, Betriebsleiter einer Mälzerei, in weißem Hemd und schwarzer Hose neben seinem silberfarbenen Opel Zafira. Der Wagen ist neu – aber Schubert kann ihn schon jetzt nicht mehr recht leiden.
Seit 25 Jahren fährt er Opel, eigentlich sehr gern, und dabei verfolgt er stets ein leicht merkwürdiges Hobby: Bei jeder Fahrt versucht er, durch cleveres Beschleunigen, Bremsen und Schalten die Verbrauchsangaben des Herstellers zu unterbieten. Schubert ist ein Meister dieses Fachs. Auch seinen vorherigen Zafira hat er immer mit seinen Tricks geschlagen und seine Siege akribisch notiert. "5,7 Liter war angegeben", erzählt er, "ich lag nach 100.000 Kilometern bei 5,35 Litern."
Doch nun, ausgerechnet mit dem neuen, als höchst umweltfreundlich gepriesenen Modell will es einfach nicht klappen. Schubert hat schon alles versucht. "Ich bin sogar auf der A 9 nach München mit Tempomat nur 100 gefahren – da hätte ich doch deutlich unter dem Normwert bleiben müssen!" Aber nein – "Ich liege im Schnitt 20 Prozent zu hoch".

Schubert hat sich darüber bei Opel beschwert. Die Zentrale schrieb ihm lapidar zurück, die Laborwerte wichen bei allen Anbietern von der Realität ab. Sie legten ihm, dem Spritsparprofi, Fahrregeln bei, mit denen er den Normverbrauch erreichen könne. Um Recht vor Gericht zu bekommen, müsste Schubert den Mehrverbrauch per Gutachten nachweisen. "Allein das würde mich mindestens 2000 Euro kosten", sagt er.
2001 verbrauchten Pkws neun Prozent mehr als im Prospekt versprochen – 2016 waren es laut der unabhängigen Forschungsorganisation ICCT ganze 42 Prozent: Mercedes 51 Prozent mehr, Audi 48, BMW 46, VW und Opel 38 Prozent mehr. Trotzdem übernehmen die Behörden die Katalogwerte der Hersteller, auch, um die emissionsabhängige Kfz-Steuer festzulegen. Dem Fiskus gehen so Milliarden Euro verloren, weil die gut 46 Millionen Pkws eigentlich die Abgasmenge von 65 Millionen Wagen ausstoßen.
Seit September 2017 unterliegen Neufahrzeuge immerhin einem strengeren Messverfahren. Es heißt WLTP und führt laut dem Verband der Automobilindustrie zu durchschnittlich 20 Prozent höheren Verbrauchsangaben in den Prospekten. Setzt man dies ins Verhältnis zu den Zahlen des ICCT, heißt das aber: Neue Autos schlucken dann im Schnitt noch immer gut 18 Prozent mehr als angegeben.
Die Last mit dem Lärm
Im Fahrradladen "Langenberg", in Edermünde-Holzhausen bei Kassel, riecht es betörend nach Gummi. Eigentümer Bernd Schmelz, beneidenswert durchtrainiert, war mal Vizeweltmeister im Straßenrennen. Die Menschen kaufen gern bei ihm, viele radeln dann hinaus ins stille Waldecker Land. Und manchmal, gar nicht selten, braucht auch Schmelz selbst nichts mehr als Ruhe. Denn an der Ostseite seines Hauses dröhnt und rauscht und rattert und hupt es ununterbrochen. Nur knapp 40 Meter entfernt verläuft die A 49. Experten der Universität Kassel haben 76 Dezibel Lärmbelastung am Tag und 72 Dezibel in der Nacht festgestellt. Das ist lauter als mancher Rasenmäher. "Kommen Sie!", sagt Schmelz, verlässt den Laden und geht hinters Haus. Er zeigt auf die Haustür und brüllt: "Die benutzen wir gar nicht mehr."
Hier zu wohnen bedeutet: Dauerstress. "Jeden Morgen um vier Uhr geht es los mit den Lastern", sagt Schmelz. Er hat das Dach gedämmt und Schallschutzfenster eingebaut, "1300 Euro jedes Fenster". Immerhin, es gab Zuschüsse von den Behörden und ruhiger schlafen können sie nun auch – zumindest bei geschlossenen Fenstern.
Früher, da war die A 49 eine beschauliche Bundesstraße. Später wurde sie eine wenig befahrene Stummelautobahn, die im Niemandsland endete. Dann jaulten immer mehr Ost-Laster und Sprinter mit den online-geshoppten Paketen vorbei, dicke, laute Geländewagen mit breiten Reifen kamen in Mode, und nun, das ist das Schlimmste, wird die A 49 auch noch verlängert. Bis zur A 5. Dann jagen noch mal geschätzt bis zu 80 Prozent mehr Fahrzeuge über die Spuren. Genervten Anwohnern wie Schmelz hat die Landesbehörde schon ausgerichtet, dass auf eine Lärmschutzwand aber dennoch kein Anspruch bestehe.

Axel Friedrich, früher Abteilungsleiter für Verkehr und Lärm im Umweltbundesamt (UBA), nennt den Umgebungslärm "die vergessene Emission". Er sagt: "Sie macht die Menschen krank und bringt sie um." Ein unglaublicher Satz. Doch tatsächlich belegen Studien seinen Befund. Dauerbeschallung kann das Gehör schädigen und Tinnitus auslösen, vor allem nachts, weil dann die Ohren sehr sensibel sind. Lärmstress lässt den Blutdruck steigen und das Herz schneller schlagen, was Herzinfarkte und Schlaganfälle auslösen kann. Friedrich hat aufgrund von UBA-Erhebungen ausgerechnet, dass pro Jahr rund 5400 Bundesbürger dem Lärm zum Opfer fallen – mehr als Verkehrsunfällen.
Dennoch schreitet niemand ein.
"An den Autobahnen wohnen vor allem die Armen, die haben keine Lobby", sagt Friedrich. Ein Tempolimit einführen? Schallschutzwände aufbauen? Das macht nur unbeliebt, und die Kommunen fürchten die Kosten. Die Europäische Union hat 2002 eine "Umgebungslärmrichtlinie" herausgegeben. Sie forderte "schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern". Das Ergebnis: Inzwischen gibt es bundesweit zwar Lärmkarten, auf denen man nachlesen kann, wie laut es vor der eigenen Haustür ist, aber es existieren noch immer keine Grenzwerte, die Behörden zu Gegenmaßnahmen zwingen könnten.
Im Schatten der Türme
In Bergheim-Rheidt westlich von Köln sitzt Walter Winkelius in seinem Wintergarten, vor dem eine deutsche Flagge weht. Winkelius hat Besuch, die Geologin Ruth Hausmann und der Ingenieur Hans-Joachim Gille sind da. Die drei leiten die Bürgerinitiative "BigBen". Ihr Gegner ragt direkt vor dem Wintergarten in den Himmel: das RWE-Braunkohlekraftwerk Niederaußem. Und nicht weit entfernt: das Werk Neurath. Nur ein einziges Kraftwerk Europas stößt mehr klimaschädliches CO2 aus als sie.
Als Winkelius das Haus 1964 von seinen Schwiegereltern übernahm, waren Treibhausgas und Klimawandel noch kein Thema. "Als weitere Blöcke genehmigt wurden, dachten wir, na ja, kann man nichts machen", sagt der ehemalige RWE-Personaler. Doch die neuen Blöcke wurden höher und mächtiger, als ihnen gesagt worden war. Ihre Heimat verschwand im Qualm der Kühltürme. Gille sagt: "Wir haben hier bis zu drei Stunden Verschattung am Tag. Im Sommer müssen wir manchmal schon um 15 Uhr das Licht anmachen."

Und jetzt, das macht sie schlicht fassungslos, jetzt will RWE tatsächlich ein weiteres 1100-Megawatt-Braunkohlekraftwerk bauen lassen – wieder direkt vor ihrer Haustür. Im Jahr 2016 haben sie beim Oberverwaltungsgericht Münster gegen die Baugenehmigung der Stadt Bergheim geklagt. Mit Erfolg. Das Gericht hat Mitte November einen Baustopp verfügt. Doch in diesen Wochen prüft die Stadt in Absprache mit RWE, ob eine Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht Erfolg haben kann.
Gille zieht eine Grafik aus der Tasche. Sie ist der Nachweis für zehn Jahre Dichtung und Wahrheit der sauberen Energieversorgung in Deutschland. Die eine Kurve zeigt, welche CO2-Emissionen RWE den Behörden für seine vier rheinischen Braunkohlekraftwerke zwischen 2007 und 2017 in Aussicht gestellt hat: Sie geht steil nach unten. Die andere Kurve offenbart, wie viel Klimagas am Ende tatsächlich austrat: Der Wert lag stets drastisch höher. Die Meiler bliesen 146 Millionen Tonnen mehr CO2 aus als avisiert – so viel, wie alle deutschen Pkws in knapp anderthalb Jahren.
Klimagipfel in Kattowitz
Bundesweit sind noch immer rund 45 Braunkohle- und 66 Steinkohlekraftwerke in Betrieb. Nicht einmal in China wird mehr Braunkohle gefördert als hier. Bulgarien, Rumänien oder Estland haben seit 1990 prozentual viel mehr Treibhausgase reduziert als Deutschland. Und dabei zahlt sich der Einsatz angeblich billiger Kohle für Verbraucher nicht einmal aus. Claudia Kemfert, Energieökonomin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, sagt: "Der hohe Anteil von Kohlestrom macht die Energiewende sogar teurer."
Deutschland – Staranwalt der geschändeten Mutter Natur?
Die 50 Millionen Euro, die der Expo-Pavillon kostet, werden schnell verblassen, wenn die Politik, die Wirtschaft, wenn wir alle weiter so umweltvergessen leben – und das Klima kippt. Auf der Weltklimakonferenz, die dieser Tage in Polen stattfindet, warnte UN-Generalsekretär António Guterres gerade: "Die Kosten dieses Desasters werden durch die Decke schießen." Und er meinte nicht nur – die finanziellen.
Der Artikel über Umweltprobleme in Deutschland ist dem aktuellen stern entnommen: