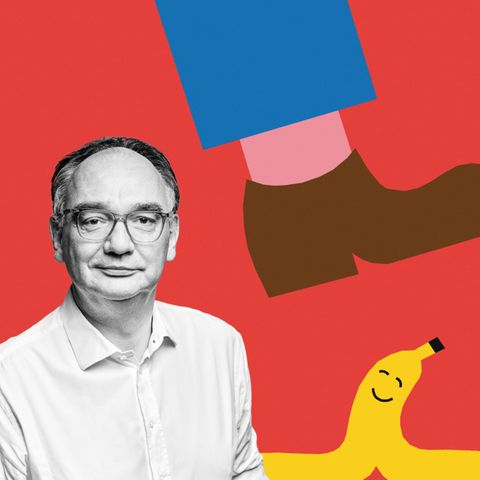Was bedeutet die Entlassung von Patrick Graichen für Robert Habeck?
Die Trennung von Graichen ist ein enormer fachlicher Verlust für den Klimaschutzminister Habeck. Graichen war, das bestreiten auch seine Kritiker nicht, einer der wichtigsten und mächtigsten Staatssekretäre der aktuellen Bundesregierung. Die unzähligen energiepolitischen Gesetze und Verordnungen, die seit Ende 2021 aus Habecks Ministerium kamen, tragen die Handschrift des früheren Chefs des Thinktanks Agora Energiewende. Nach der Regierungsübernahme der Ampel steuerte der als Experte international angesehene Graichen zunächst für Habeck den Neustart in der Klimapolitik, für die er in seiner früheren Rolle bereits Blaupausen entwickelt hatte.
Kurz darauf, nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, wurde er der wichtigste Mann des Vizekanzlers im Kampf gegen die Energie- und Gaskrise. Graichen war zuständig für den Bau der LNG-Terminals, die Reaktivierung von Kohlekraftwerken zur Vermeidung von Stromengpässen, für die Frage der AKW-Laufzeiten, die später zurückgenommene Gasumlage, zuletzt auch für das hochumstrittene Heizungsgesetz der Ampel. Als der Spitzenbeamte Ende des vergangenen Jahres einmal von Journalisten gefragt wurde, wer im Ministerium angesichts der vielen Krisenherde und Großbaustellen noch den Überblick und die Kontrolle habe, antwortete er: Er selbst. Nicht von ungefähr versuchte Habeck bis zuletzt, an Graichen trotz der unbestreitbaren Fehler in der sogenannten Trauzeugen-Affäre festzuhalten. Die Entlassung nannte Habeck am Mittwoch eine "dramatische Konsequenz". Tatsächlich trifft dies nicht nur für Graichen zu, sondern auch für den Minister selbst.
Warum muss Graichen jetzt gehen?
Wochenlang hatte Habeck seinen Vertrauten verteidigt, Graichens Leistungen bei der Verhinderung eines Gasnotstands nach dem russischen Einmarsch betont. Noch vergangene Woche erklärte er trotzig, er werde Graichen nicht entlassen, die Kritik sei überzogen und Teil einer Kampagne. Nun aber, so sagte es der Minister am Mittwochmorgen bei einem kurzfristig angesetzten Pressetermin, sei im Zuge der ministeriumsinternen Prüfungen der Aufträge und "Zuwendungen" an Klimaschutzorganisationen, bei denen es Verbindungen zu Graichen und dessen Familie geht, ein "neuer Sachverhalt aufgetaucht".
Dabei geht es laut Habeck um eine geplante Förderung für den Berliner Landesverband der Naturschutzorganisation BUND im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative in Höhe von knapp 600.000 Euro. Für die Klimaschutzinitiative konnten sich Vereine und Verbände um eine Förderung bewerben, aus 29 Bewerbungen hatte laut Habeck ein externer Dienstleister drei förderfähige Projekte ausgewählt. Im November 2022 billigte Graichen als zuständiger Staatssekretär eine entsprechende Vorlage von unteren Ministeriumsebenen – obwohl seine Schwester in der Spitze des Berliner Landesverband des BUND aktiv ist, bis Mai 2022 auch als Landesvorsitzende. Daher sei die Billigung der Förderung durch den Staatssekretär "als Complianceverstoß zu bewerten", sagte Habeck.
Darüber hinaus habe es auch bei der Besetzung einer Expertenkommission zum Monitoring der Energiewende Auffälligkeiten gegeben – hier geht es um die Berufung des Chefs des Freiburger Öko-Instituts, bei dem Graichens Bruder Jakob arbeitet. Die beiden "Fehler" seien unterschiedlich zu bewerten, sagte Habeck, in Summe aber sei es "der eine Fehler zu viel". Die "Compliance-Brandmauer", die nach der Amtsübernahme im Ministerium mit Blick auf familiär bedingte Interessenkonflikte eingezogen wurde, habe "Risse bekommen".
Verschafft sich Habeck nun Ruhe?
Seit dem Bekanntwerden der sogenannten Trauzeugen-Affäre um Graichen Ende April haben Habeck und seine Strategen versucht, den Schaden mit einer mantraartigen Formel zu begrenzen: Ja, bei dem Zuschlag für Graichens Trauzeugen Michael Schäfer bei der Besetzung der Spitze der Deutschen Energieagentur (Dena) sei ein "Fehler" passiert, Graichen hätte sich aus dem Besetzungsverfahren zurückziehen müssen. Aber dieser Fehler werde nun "geheilt", das Verfahren neu aufgesetzt.
Dennoch wurde schon sehr bald klar, dass diese Verteidigungslinie nicht ausreicht, um die Affäre abzuräumen – auch weil Graichen als Architekt des umstrittenen Heizungsgesetzes für politische Gegner und Vertreter von bestimmten Industrieinteressen als Zielscheibe diente. Nicht nur die Opposition bemühte sich, den Fall Graichen zu einem Fall Habeck zu machen – auch unter Verwendung teils heftig überzogener Clan-Vergleiche. Tatsächlich gibt es aber auch bei den Grünen, ebenso wie bei Union, SPD und FDP, Netzwerke, bei denen die Gefahr eines Parteienfilzes bestehen kann – insbesondere, nachdem die Grünen seit Ende 2021 in der Bundesregierung sitzen.

Inzwischen werden nun auch andere Personen, die Habeck auf dem Grünen-Ticket in die Führungsetage seines Ministeriums holte, auf mögliche Interessenkonflikte hin durchleuchtet – etwa der beamtete Staatssekretär Udo Philipp, über dessen Geschäfte mit dem Grünen-Großspender und Greentech-Investor Jochen Wermuth "Capital" bereits im Januar berichtete. Philipp war einst Deutschlandchef des schwedischen Finanzinvestors EQT, später gründete er mit dem heutigen Habeck-Staatssekretär Sven Giegold und dem Ex-Grünen-Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick die Anti-Finanzlobby-Organisation Bürgerinitiative Finanzwende, bevor er als Quereinsteiger auf dem Grünen-Ticket in die Politik kam. Am vergangenen Wochenende berichtete das Portal "Business Insider" über Philipps Investments in Start-ups.
Bislang weigert sich der Staatssekretär, der im Wirtschaftsministerium heute unter anderem auch für die Start-up-Branche zuständig ist, seine konkreten Investments offenzulegen. Hier könnte noch ein weiterer Brandherd für Habeck entstehen, der potenziell ähnliche Dimensionen annehmen könnte wie im Fall Graichen.
Was bedeutet Graichens Entlassung für das Heizungsgesetz?
Erst einmal gar nichts. Graichen gilt zwar als Architekt des sogenannten Gebäudeenergie-Gesetzes, mit dem die Ampel den Einbau neuer fossiler Heizungen ab 2024 weitgehend verbieten will. Seine Entlassung hat aber keine Auswirkungen auf das Gesetzgebungsverfahren – auch wenn manch ein Gegner des Heizungsgesetzes darauf insgeheim hoffen mag. Viel wichtiger als die Personalie wird sein, ob sich die Bundesregierung intern zusammenraufen kann.
Beim Kabinettsbeschluss haben sich die FDP-Minister in einem bemerkenswerten Vorgang mit einer Protokollerklärung von dem eigenen Gesetz distanziert und setzen auf Änderungen im parlamentarischen Verfahren im Bundestag. Auch der Bundesrat hat Änderungen gefordert. Den Kampf gegen eine Verwässerung seiner Gesetzespläne muss Habeck nun ohne Graichen führen.
Wer wird Graichens Nachfolger?
Das ist noch unklar. Bei seinem Presseauftritt versicherte Habeck, er werde "so schnell wie es geht" einen neuen Staatssekretär berufen. Dabei muss er zwei Dinge unter einen Hut bringen: Graichens Nachfolger muss das absolute Vertrauen des Vizekanzlers genießen, darf aber nicht aus den Zirkeln stammen, bei denen ähnliche Interessenkonflikte bestehen können wie bei Graichen. Nicht nur wegen des Gesetzgebungsverfahrens zum Heizungsgesetz besteht dabei hoher Zeitdruck.
Anders als der frühere Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der in der letzten Großen Koalition den zentralen Posten des Energie-Staatssekretärs monatelang vakant ließ, weil er diverse Absagen kassierte, muss Habeck zügig einen Nachfolger präsentieren. Er plane eine Nachbesetzung noch "vor der Sommerpause", sagte er. Um Interessenkonflikte zu verhindern, werde er bei den Kandidaten eine "aktive Abfrage" nach deren Verbindungen in die Klimaschutz- und Energieszene vornehmen.
Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll Habeck als Graichen-Nachfolger den Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, favorisieren – auch er Grünen-Mitglied und bislang schon Habecks zweitwichtigster Mann in der Gas- und Energiekrise. Offiziell teilte der Minister am Mittwoch zunächst nur mit, wer den Posten auf keinen Fall erhalten wird: "Ich werde nicht meinen Trauzeugen als Staatssekretär berufen."
Dieser Artikel erschien zuerst an dieser Stelle beim Wirtschaftsmagazin "Capital", das wie der stern zu RTL Deutschland gehört.