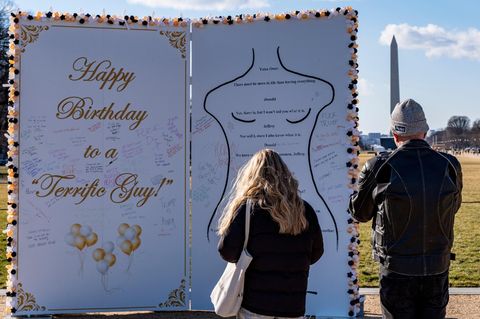Herr Professor Güllner, der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner fordert seine Partei auf, mit einem klaren linken Programm in den Wahlkampf zur nächsten Bundestagswahl zu ziehen. Nur so könne die SPD wieder mehr Wähler gewinnen. Hat er recht?
Parteichef Sigmar Gabriel und der gescheiterte letzte Kanzlerkandidat Peer Steinbrück haben – wenn auch mit reichlich Verspätung – eingesehen, 2013 den falschen Wahlkampf geführt zu haben. Sie raten ihrer Partei an, sich wieder mehr in der Mitte der Gesellschaft zu positionieren. Aber die Partei-Linke um Stegner ist leider nicht klüger geworden. Würde die SPD auf die Wahlberechtigten im Lande hören, wäre die Entscheidung zwischen beiden Positionen klar: Eine Mehrheit der Bundesbürger empfiehlt der Partei, wieder stärker auf die mittleren Schichten der Gesellschaft zuzugehen. Nur eine Minderheit hält Stegners Linkskurs für richtig.
Was noch nicht heißt, dass diese Mehrheit die SPD auch wählen würde.
Aber die Einschätzung derer, die der SPD zur Positionierung in der Mitte raten, wird auch durch einen Blick auf die Wahlgeschichte bestätigt. Nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus erfüllte sich die Hoffnung der SPD auf eine Regierungsübernahme nicht - weil sie zu sehr traditionellen Dogmen verhaftet war und nur von ihrer angestammten Kernklientel gewählt wurde. Erst als sich die SPD nach Adenauers Triumph bei der Bundestagswahl 1957 mit dem Godesberger Programm von ihrem ideologischen Ballast befreite, wurden die deutschen Sozialdemokraten auch für neue Wählerschichten aus der bürgerlichen Mitte wählbar. Zum "Genossen Trend“, also der Mobilisierung der traditionell linken gewerkschaftlich gebundenen Arbeiter, gesellte sich der "Bürger Trend“, also Wanderungen zur SPD aus dem immer größer werdenden Bereich der Angestellten aus dem Dienstleistungssegment.
Derzeit sei die Personaldecke der SPD einfach zu dünn, haben Sie wiederholt im stern kommentiert. Braucht die Partei nicht starke Figuren, um wieder mehr Wähler aus der Mitte zu binden?
Natürlich. Während der ersten Großen Koalition von 1966 bis 1969 stellte die SPD ihre Regierungsfähigkeit durch exzellentes Personal unter Beweis. Bei der nachfolgenden Bundestagswahl war Karl Schiller mit seiner großen ökonomischen Kompetenz das personale Symbol des SPD-Mottos "Wir schaffen das moderne Deutschland“. So konnten die Sozialdemokraten nach 20-jähriger CDU-Dominanz die zum ersten Mal den Kanzler stellen. Durch die "Schiller-Wähler“ stieg der SPD-Anteil 1969 auf 36,4 Prozent aller Wahlberechtigten - im Vergleich zu 1949 ein Zuwachs von 64 Prozent! Mit Willy Brandts "Mehr Demokratie wagen“ und dem Plebiszit über die Brandtsche Ostpolitik schaffte es die SPD dann 1972 endlich, auch zur stärksten politischen Kraft in Deutschland zu werden.
Was sie allerdings nicht mehr lange blieb.
Weil eine Re-Ideologisierung der SPD einsetzte. "Überbildete“ Mitglieder aus dem 68er-Milieu verprellten zunehmend die mühsam gewonnenen Wähler der Mitte. Zwar konnte Helmut Schmidt dank des großen Vertrauens, das er genoss, größere Wählerverluste bei den Wahlen 1976 und 1980 verhindern. Doch auf lokaler Ebene verlor die SPD zahlreiche Hochburgen wie Frankfurt oder München. Nach Helmut Schmidts Sturz 1982 begann der Abwärtstrend der SPD dann auch auf Bundesebene. Die Partei war damals nach Meinung vieler Linker zwar "wieder auf der Höhe der Zeit“ – so noch heute der Journalist Stefan Reinecke in der taz –, aber sie musste 16 Jahre lang die Oppositionsbank drücken, weil sie die Mittelschichten nicht mehr erreichte. Das änderte sich erst wieder mit dem Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder und dem Slogan "Innovation und Gerechtigkeit“.
Warum konnte Schröder mit einem solchen Slogan punkten?
1998 war "Innovation“ das Schlüsselwort, also die von Schröder versprochene Erneuerung und Modernisierung des Landes, das Kohl in einem Reformstau hinterlassen hatte. Mit Schröder wurde die SPD bei den Bundestagswahlen 1998 und 2002 auch wieder stärkste Partei. Die Schrödersche Reformpolitik wurde zwar von einer Mehrheit der Bürger für richtig befunden, doch die eher linken Dogmen verhafteten SPD-Führungskader torpedierten Schröders "Agenda“-Politik, sodass 2005 mit der vorgezogenen Neuwahl des Bundestags das Ende des rot-grünen Interregnums vorprogrammiert war.
Weshalb gelang es der Partei nicht, mit dem wirtschaftlichen Erfolg der "Agenda“-Politik wieder Wähler zu mobilisieren?
Bei Schröders Abwahl 2005 kam die SPD noch auf über 34 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen – ein Ergebnis, über das die Partei heute lauthals jubilieren würde. Doch die Erfolge der Schröderschen Reformpolitik hat die SPD dann selbst zerredet. Und mit dem Links-Schwenk von Kurt Beck verschreckte die SPD wieder ihre Anhänger aus der Mittelschicht und verlor 2009 die Hälfte ihrer Wähler von 1998: Wählten 1998 noch über 20 Millionen Wahlberechtigte die SPD, waren es 2009 noch nicht einmal mehr 10 Millionen. 2013 waren es dann mit 11 Millionen noch immer 9 Millionen weniger als 1998. Gegenwärtig wollen nur 17 von 100 Wahlberechtigten der SPD ihre Stimme geben. Man muss in der Wahlgeschichte Deutschlands schon bis zu den Reichstagswahlen 1924 beziehungsweise 1932 oder 1933 zurückgehen, um auf ähnlich niedrige Mobilisierungsraten für die SPD zu stoßen.
Wie kann es nun mit der SPD weitergehen?
Bei keiner Bundestagswahl seit 1949 hat die SPD eine Wahl mit den von der Parteilinken geforderten Umverteilungsthemen gewonnen. Diese Tatsache und auch die aktuelle Einschätzung der Wahlberechtigten könnten der SPD also den richtigen Weg aufzeigen, um wieder mehrheitsfähig zu werden. So wie 1997/1998 alle ausländischen – aber nur wenige deutsche – Journalisten die Frage stellten, ob die SPD mit Schröder gewinnen oder mit Lafontaine verlieren will, so lautet heute die Frage: Will die SPD mit einer Positionierung in der Mitte wieder verloren gegangenes Vertrauen bei den Wählern zurückgewinnen oder mit Stegners Linksruck vollends den Weg in die Bedeutungslosigkeit gehen?