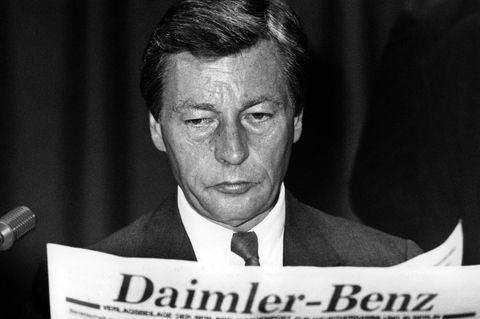Stuttgart-Stammheim, 9. Mai 1976: Am frühen Morgen finden Beamte der Justizvollzugsanstalt die Leiche der Terroristin Ulrike Meinhof in ihrer Zelle. "Selbstmord durch Erhängen", so lautet die Schlagzeile zum Tod einer Frau, die sich von einer engagierten Journalistin zur Staatsfeindin Nummer eins gewandelt hatte. Meinhof gehörte neben Andreas Baader und Gudrun Ensslin zu den führenden Köpfen der RAF.
Damals wurde der Hochsicherheitstrakt des Stuttgarter Gefängnisses zum Symbol für eine Justiz im Ausnahmezustand. Meinhofs Tod löste neben Mordvorwürfen gegen die staatlichen Behörden eine Welle der Gewalt im In- und Ausland aus. Die Beisetzung Meinhofs am 15. Mai 1976 in Berlin wurde zu einer großen Demonstration.
"Traurigster Irrweg der Justizgeschichte"
Auch 26 Jahre nach ihrem Tod sind die Ereignisse von damals noch lange nicht vergessen. "Die Vorstellung, dass politische Ziele mit Gewalt durchzusetzen sind, war der traurigste Irrweg der deutschen Justizgeschichte der Nachkriegszeit", sagt Baden-Württembergs Justizminister Ulrich Goll (FDP), der die RAF-Prozesse als 26-jähriger Rechtsreferendar miterlebte. Er bezeichnet die Phase um den Tod Meinhofs als die schwierigste nach dem Zweiten Weltkrieg. Für die Justizorgane sei sie eine "Riesenherausforderung" gewesen, die allerdings erfolgreich bewältigt wurde.
Nach übereinstimmenden Untersuchungen mehrerer Mediziner erhängte sich die damals 41-jährige Ulrike Meinhof mit einem Strick aus Handtüchern am Gitterfenster ihrer Zelle. Später gab es immer wieder Zweifel an dem Selbstmord. Allerdings konnte die Theorie einer Tötung Meinhofs nie bestätigt werden.
Eltern bereits als Kind verloren
Meinhof wurde am 7. Oktober 1934 in Oldenburg geboren. Ihre Eltern, beide Kunsthistoriker, verlor sie bereits als Kind. Die 14 Jahre ältere Historikerin Renate Riemeck - Freundin ihrer Eltern - wurde Meinhofs zweite Mutter. Im Hause der Professorin, die später die Deutsche Friedens-Union (DFU) gründete, wurde sie schon in jungen Jahren mit sozialistischen und pazifistischen Ideen vertraut gemacht.
Nach dem Abitur studierte Meinhof Philosophie, Pädagogik, Soziologie und Germanistik in Marburg und Münster. Die Wandlung von der Bürgerlichen zur Untergrundkämpferin begann gegen Ende der 50er Jahre, als sie "ihren Proust und Kafka" einmal beiseite legte und "die politische Arena betrat", wie ihre Wahlmutter es beschrieb.
Nach und nach nahm Meinhof von ihrem bisherigen Leben Abstand: Zwischen 1960 und 1964 schrieb sie als Chefredakteurin der linksorientierten Zeitschrift "Konkret" leidenschaftliche Artikel gegen die Atombewaffnung und das amerikanische Engagement im Vietnam-Krieg. Sie kämpfte außerdem für eine neue Ostpolitik und gegen die Notstandsgesetze in der Bundesrepublik. 1961 heiratete sie den Herausgeber von "Konkret", Klaus Rainer Roehl. Bereits 1968 kam es zum Bruch zwischen den beiden und schließlich auch zur Scheidung.
Bruch mit dem Bürgertum
Meinhof zog mit ihren Zwillingen Bettina und Regine nach Berlin. Dort war ihr Bruch mit der bürgerlichen Welt bald endgültig. Sie schloss sich anarchistischen Kreisen an und verschwand mit der von ihr 1970 gegründeten, nach ihr und Baader benannten "Baader-Meinhof-Gruppe" und der RAF im Untergrund.
Auf das Konto der Terroristen gingen in den folgenden Jahren Sprengstoffanschläge, Banküberfälle und Schießereien, bei denen mehrere Menschen getötet werden. Ulrike Meinhof wurde zur meistgesuchten Frau Deutschlands. Im Juni 1972 wurde sie festgenommen und 1974 zu acht Jahren Haft verurteilt.