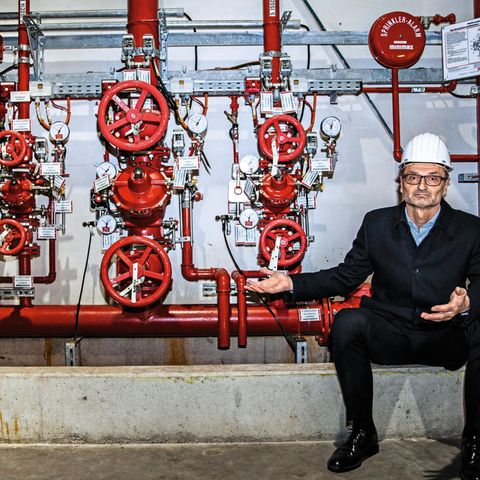Es ist alles andere als unverfänglich, jetzt die Klimakrise als Thema aufzubringen. Ob man das darf, wer das darf, ab wann man es darf – alles ungeklärt. Wer andere Themen mit Corona verknüpft, läuft Gefahr, der Instrumentalisierung bezichtigt zu werden. Formuliert man politische Forderungen, steht die Vermutung im Raum, man wolle von einer Pandemie profitieren. Vermintes Feld. Einigkeit herrscht darüber, dass jetzt Corona dran ist, Klima kommt später. Morgen oder nächstes Jahr.
Daher sachte. Die Sache ist nur die: Genau wie sich die Biologie hinter Corona unbeeindruckt zeigt von einem US-Präsidenten, der das Virus mit breitbeiniger Polemik zu beherrschen meint, zeigt sich die Physik hinter der Klimakrise unbeeindruckt von der Menschheit im pandemischen Ausnahmezustand.
Dieses Jahr ist extrem wichtig für die Bewältigung der Klimakrise
Wir haben noch immer das Jahr 2020 - und dieses Jahr ist ausschlaggebend für die Chancen, die Klimakrise einzudämmen. Es ist auch das Jahr, in dem sich die Klimakrise unweigerlich verschärfen wird. Ein Jahr, in dem trotz allem Nachbarschaften geflutet, Häuser brennen und Stürme toben werden. Deshalb darf man die Klimafrage nicht nur aufwerfen, man muss es sogar. In vollem Bewusstsein über die dringende Notwendigkeit alles zu tun, um Corona schnell und wirksam zu bewältigen.
Es wäre besser für uns, für die Menschheit, immer nur ein großes, dringendes Menschheitsproblem zu haben. Doch nun haben wir eben zwei. Immerhin: Das Geflecht dieses bemerkenswert ungleichen Corona-Klima-Krisenpaares lässt sich lichten. Und das kann sogar etwas wie Mut machen. Es folgen: Klima, Corona, und drei Bedingungen für gute Zusammenarbeit.
Es ist verlockend, vielleicht auch intuitiv, die Coronakrise mit der Klimakrise gleichzusetzten und lieber zu viele als zu wenige Parallelen zu ziehen. Denn die Klimakrise als Referenzkrise liegt nahe: Beide sind globale Krisen, auf beide sind beziehungsweise waren wir wider besseres Wissen nicht gut vorbereitet, beide treffen auf eine hoch globalisierte Welt, die deutlich verletzlicher ist, als sie es selbst wahrhaben will. Und, beide Krisen verlangen von uns generationen- und grenzüberschreitende Solidarität. Nicht zuletzt schafft sich der Mensch offenbar immer wieder Probleme, die nur gelöst werden können, wenn man auf die fortgeschrittensten Wissenschaften der Welt hört, auf Virologen und Klimatologen.
Die beiden Krisen sind trotz allem sehr unterschiedlich
Wir können wir also krisenübergreifend voneinander lernen? Soweit so gut. Problematisch ist eine überschwängliche Krisengleichsetzung dennoch – sie verhindert, dass man beiden Krisen in ihrer Eigenheit gerecht werden kann. Man läuft Gefahr, im Zweifel sogar ungewollt, die eine Krise für das andere zu missbrauchen (ganz mies) oder sie gegeneinander auszuspielen (hilft niemanden) oder unfreiwillig Krisenhierarchien aufzumachen. Und dann hat man schon verloren.
Wer Corona und Klima gerecht werden will, sollte die Unterschiede der Krisenerscheinungen anerkennen. Von denen gibt es reichlich. Man denke an die Verantwortlichen: Schuld an der Existenz der Klimakrise sind irgendwo alle, am meisten jedoch noch die reichsten Staaten der Welt, die großen Industrien und deren Finanziers, damit aber auch die Endverbraucher. Die Schuldfrage ist beim Klima kompliziert und sie ist eine Quelle ständiger Ausflüchte, denn am Ende sind es immer die anderen.
Die Coronakrise ist auch ein schlimmer Zufall
Bei der Coronakrise stellt sich die Frage zumindest in erster Instanz nicht. Sicher, man könnte naturphilosophisch oder epidemiologisch darauf eingehen, wie wir den Wildtieren zu nahe kommen und wie Epidemien tierischen Ursprungs so wahrscheinlicher werden. Man kann auch die Globalisierung mitdenken. Aber all das ist nie mehr als ein Zusatz zu einem unglücklichen, fatalen Zufall. Ein Zufall, für den man niemanden in die Pflicht nehmen - oder aus ihr entlassen kann.
Weiter zur Lösung: Man hört oft davon, dass beide Krisen eine "flatten the curve" gemein haben. Das funktioniert genau so lange, wie die Achsen des Diagramms vollkommen ignoriert werden. Bei Corona sprechen wir davon, innerhalb von ein, maximal zwei Jahren Zahlen von Infizierten so zu reduzieren, dass die Gesundheitssysteme nicht überlastet werden. Am Ende des Tages wird es aber schlicht eine Impfung sein, die das Virus ultimativ überwältigen kann.
Bei der Klimakrise hingegen geht es um Emissionskurven, die sich aus zahllosen verschiedenen Quellen addieren, die sich seit mehr als 100 Jahren aufbäumen und über die nächsten 100 Jahre und darüber hinaus abgeflacht werden müssen. Voraussetzung dafür ist eine grundlegende langfristige Transformation über Jahrzehnte hinweg in faktisch allen Lebensbereichen. Ja, Kurvengestaltung haben die zwei Krisen gemein, die Dimensionen sind jedoch kaum zu vergleichen.
Für viele ist die Klimakrise noch immer etwas, das weit weg ist
Und schließlich, dies ist offensichtlich nicht mein Lieblingsaspekt der zwei Krisen, die politische Einordnung: Die globale Erwärmung wird zurecht als Krise bezeichnet, das Krisennarrativ hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt. Umgesetzt wurde das allerdings nicht, die Klimakrise passiert in der breiten Wahrnehmung weit weg, zeitlich und räumlich, akutes Handeln ist verzichtbar. Da konnten noch so viel zehntausende Expertenstimmen, und noch so viel hunderttausend Kinderstimmen vor dem Kanzleramt zusammenkommen – Krise war das Klima, bisher, nur dem Namen nach. Praktisch nicht. Dass Corona eine Krise ist, braucht keine großen Erklärungen, wer keinen emotionalen Krisenstress empfindet, tut es mittlerweile definitiv sozioökonomisch und zwangsläufig räumlich.
Auf den ersten Blick weiter verkompliziert wird die Gemengelage der zwei doch recht unterschiedlichen Krisen zusätzlich durch die Sache mit den Emissionen, die sinken ja nun. Kommt Corona Natur und Klima zu Gute? Es grünt und blüht nämlich, wenn Menschen mal eine Sekunde mit dem ökologischen Raubbau aufhören, und sich unfreiwillig auf das beschränken, was Biologen "friedliche Koexistenz" nennen. Wenig überraschend.
Oder vielleicht doch. Auch das wäre ein Perspektive, hurra, wir haben noch nicht alles kaputt gemacht. In jedem Fall lernen wir: Die Natur braucht den Menschen offensichtlich nicht, der Mensch die Natur schon. Wir ahnten schon, was wir jetzt erleben. Und wenn Wirtschaften schrumpfen oder zusammenbrechen, sinken Emissionen, egal unter welchen Umständen. All das war absehbar und vor allem schlicht eine nicht-intendierte Nebenfolge einer Wirtschaftskrise. Dem Klima ist damit nicht geholfen, denn Klimaschutz braucht Planbarkeit und vor allem Verlässlichkeit. Nach der Finanzkrise, als auch ein Emissionseinbruch auszumachen war, schnellten die Emissionen danach global um 5,9 Prozent in die Höhe, Rebound Effekt nennt man das. Könnten wir wirklich gar nicht gebrauchen nächstes Jahr.
Die Bewältigung der einen Krise darf die andere nicht noch verschlimmern
Jetzt stehen wir da, konfrontiert mit zwei tendenziell ungleichen, globalen Krisen, bei denen wir gefragt sind, große und großartige Antworten zu liefern. Zwei Krisen, die sich aber partout nicht voneinander trennen lassen, eben weil sie zwangsläufig aufeinanderprallen werden. Weil sie im selben historischen Zeitfenster auf die Menschheit einfallen und nach Aufmerksamkeit brüllen. Und weil in genau diesem Zeitfenster Lösungen präsentiert werden müssen, die die Krisen nicht gegenseitig verschlimmern. Wenn das 1,5-Grad-Ziel mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit eingehalten werden soll, braucht es noch in diesem Jahr signifikante klimapolitische Zusagen, die Emissionsziele in allen Ländern der Welt deutlich zu steigern und einzuhalten. So der Weltklimarat. Ich weiß, scheiß Timing.
Wie kommt man da jetzt, in aller Komplexität, zusammen?
Erstens: Je schneller, effektiver und gerechter wir Covid-19 bewältigen, desto mehr Leiden kann verhindert werden, und desto geringer die Schäden, wirtschaftlich, sozial und eben auch klimapolitisch. Denn schon eine Krise ist zu viel, zwei Krisen von diesem Kaliber eine Zumutung. #Zuhausebleiben, Maske tragen, solidarisch handeln kann auch klimapolitisch verstanden werden, im Sinne von: Die eine Krise rasch überwinden, um sich der anderen umso entschiedener zuwenden zu können. Das reicht aber noch nicht.
Zweitens, die größte denkbare Gemeinsamkeit der beiden Krisen liegt nicht so sehr in ihren Verlaufskurven oder in ihrer Globalität, sondern in ihren Lösungen. Die große Frage dieses Jahres der Doppelkrise lautet: Wie kann man die von Corona ausgelöste Wirtschaftskrise so lösen, dass es dem Klima nützt? Die Antworten auf Corona dürfen die Klimakrise nicht noch bedrohlicher machen, als sie ohnehin schon ist. Klingt logisch, ist leider nicht selbstverständlich.
Wie können wir die Wirtschaftskrise klimafreundlich bewältigen?
Im ganz Großen ist denkbar, dass die Abermilliarden, die dieses Jahr in Deutschland (und weltweit) noch fließen werden, darüber entscheiden werden, ob Paris noch umzusetzen sein wird oder nicht. Dieses Geld wird Grundsteine zementieren für die Ökonomien der Zukunft. Wer kalibriert diese Hebel auf den Faktor Klima? Auf anderen Eben werden gerettete Industrien langfristig Finanzauflagen erfüllen müssen. Werden sie auch ökologische Auflagen bekommen? Wer verhindert durch kluge und nachhaltige Krisenbewältigung, dass die Emissionen im Anschluss wieder ungebremst in die Höhe schießen?
Man kann aus so einer Krise gestärkt hervorgehen, aber nicht, wenn auf dem Absatz in die nächste hinein hineinschlittert. Umso erbärmlicher ist nun der Vorstoß von Vertretern der Autoindustrie, im Namen von Corona doch die strengeren europäischen Auto-Grenzwerte zu kippen. (So sieht es übrigens aus, wenn eine Krise instrumentalisiert wird, um die andere zu verschärfen.) Und das wird erst der Anfang sein.
Optimismus ist wichtig
Und drittens: Die Klimabewegung möchte Gesellschaften für eine lebensbejahende Krisenbewältigung begeistern. Was wir gerade erleben, ist vieles - nur ist es sicherlich nicht lebensbejahend. Plus, Lust auf noch mehr Krise macht das ganz sicher nicht, und ich bezweifle, dass Menschen in diesem Land gerade euphorische Minimalismus-Erfahrungen sammeln. Klimaschützerinnen wollen eines ganz bestimmt nicht: Dass die Menschen gezwungen werden, zuhause zu blieben, dass sie nicht mehr ins Theater und ins Kino gehen und dass sie ihre Familien nicht besuchen dürfen. Klimapolitik ist lebensbejahend und menschenfreundlich. Das Gegenteil von Corona-Politik.
Wer also Klima und Corona vermischt, undifferenziert von dem einen auf das andere schließt, läuft nicht nur Gefahr sich zu verrennen. Man zeichnet so auch ein Bild einer generischen Krise, auf die es scheinbar nur eine Antwort gibt. Und die schmeckt autoritär, nach Freiheitsbeschränkungen und Zukunftsangst. Eine nachhaltige Klimapolitik möchte genau dies verhindern.
Es ist durchaus denkbar, dass wir die beiden Krisen so synchronisieren, dass sie für uns ertragbar werden. Vorausgesetzt, wir schaffen es, dort voneinander zu lernen, wo es hilft, und trotzdem Diskrepanzen aushalten. Wir werden ganz schön wachsen müssen, an dieser ungeplanten Krisen-Kooperation. Und wir werden lernen müssen zu träumen, von Krisenbewältigungs-Zukünften, die wir gestalten wollen. "I want you to panic" sagen schließlich schon die Bilder in der Tagesschau. "I want you to dream – and to act".
Quellen: "Klimareporter", "Klimareporter", "Süddeutsche Zeitung"