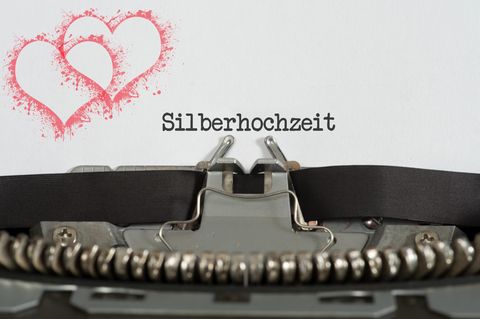Wie ein König steht Manfred Baasner da, die Lippen unter dem grauen Schnauzbart geschürzt, die Hände auf das Geländer der Laderampe gestützt, neben sich eine Kiste welker Karotten. Baasner leitet die Tafel Bochum-Wattenscheid, die größte in Deutschland. Aus verkniffenen Augen blickt er herab, das hier ist sein Reich.
Auf dem Parkplatz vor ihm hasten an diesem Morgen Menschen zur alten Lagerhalle, wo es die Almosen gibt. Trolleys rumpeln über den Asphalt. Früher kannte Baasner die meisten, die hierherkamen. Doch heute? "Immer mehr Fremde", brummt er. Frauen mit Kopftüchern, Männer mit langen Vollbärten und Smartphones. "Inzwischen haben wir 80 Prozent Asylsuchende." Man versteht ihn kaum, seine Stimme verliert sich zwischen den Rufen von unten und dem Röhren der Lieferwagen, die ausrücken, um alte Lebensmittel bei den Supermärkten der Umgebung einzusammeln. Baasner rückt seine Schlägermütze zurecht und wendet sich ab. "Es läuft was richtig schief in Deutschland."
Die Warteschlange der Bedürftigen windet sich schon jetzt, kurz nach Öffnung des Barmherzigkeitsvereins, mehr als 50 Meter über den Hof, zwischen parkenden Autos hindurch. Je länger sie wird, desto gereizter die Stimmung. Alle bekommen bei der Anmeldung bunte Kärtchen - die Eintrittserlaubnis für eine bestimmte Stunde. Eine Farbtafel zeigt, wer dran ist. Jetzt sind es die roten. Aber daran halten sich nicht alle. "Jetzt nur rooohooot!", schreit eine Mitarbeiterin. "Neeeeiiin, hinten anstellen!"
Ein junger Mann mit blonden Haaren will sich durchmogeln."Haaalloo!", ruft sie. "So nicht!" Eine alte Frau hält ihr stumm irgendein Dokument entgegen, sie übersieht es.
Dann rauscht ein Vater mit einem Kinderwagen heran, er schreit: "Ill! Ill! Ill!" und zeigt mit dem Daumen auf das Baby. "Nix mit krank", ruft die Kontrolleurin. "Lassen Sie das Kind nächstes Mal zu Hause!"
"Scharmuta!", raunzt der Mann auf Arabisch: Schlampe!

Es geht ums Geld – der Finanz-Newsletter
Ob Bausparvertrag oder Bitcoin – machen Sie mehr aus Ihrem Geld: Der stern weist Ihnen in diesem Newsletter den Weg durch den Finanz-Dschungel, kompakt und leicht verständlich, mit konkreten Tipps für den Alltag. Immer freitags in Ihrem Postfach. Hier geht es zur Registrierung.
Baasner, der Tafelkönig, steht in der Morgensonne und beobachtet die Szene. "Es tut manchmal richtig weh, wie das hier läuft" , sagt er. Er wirkt wie zerrissen zwischen dem Stolz, von so vielen Menschen gebraucht zu werden, und der Einsicht, dass es so nicht weitergehen kann.
Rund 11.000 Menschen müssen Baasner und seine rund 160 Helfer jede Woche versorgen, vor Kurzem waren es noch 8.000. Vor Feiertagen reicht die Schlange manchmal bis zur Straßenbahnhaltestelle. Dann muss sich der 72-Jährige auch noch von Anwohnern beschimpfen lassen, er fördere Sozialschmarotzertum.
Der Verteilungskampf eskaliert
Bei der Tafel in der Laubenstraße eskaliert, wovor viele seit Monaten warnen: der Verteilungskampf am unteren Ende der Gesellschaft. Gerade dort, unter den Ausgegrenzten und Armen, bei denen Hartz IV und Renten nicht zum Leben reichen, fühlen sich viele ohnehin vernachlässigt vom Staat. Die Flüchtlinge haben dieses Gefühl nur noch verstärkt. "Für die macht ihr alles, für uns macht ihr nichts" , lautet der Vorwurf, den Politiker wie Sigmar Gabriel immer wieder hören. Niemand dürfe in Deutschland schlechter leben, nur weil die Flüchtlinge kommen, warnte der SPD-Chef darum vor Wochen schon. Er fürchte sonst, "dass uns die Gesellschaft auseinanderfliegt".
Es verschiebt sich etwas. Das soziale Gefüge, so die Sorge, könnte durcheinandergeraten. Hartz-IV-Empfänger oder Rentner, Roma oder Aussiedler - auch am unteren Rand der Gesellschaft hatte jeder eine klare Vorstellung, wo er steht und was er zu erwarten hat. Mit den Flüchtlingen droht das zu verwischen. Die Angst vor dem Statusverlust mischt sich mit der Angst, nicht mehr genug abzubekommen. Ob bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum oder eben nach ein paar Tüten mit Essensspenden.
Manfred Baasner steckt die Hände in die Jackentaschen und steigt von der Laderampe. Fertig zum Rundgang durch sein Reich, das in einem ehemaligen Baumarkt untergebracht ist. Sortierhalle, Ausgabestelle, Sozialkaufhaus, Sprachschule. Als er die Tafel vor rund 16 Jahren ins Leben rief, wollte er vor allem Menschen unterstützen, die unter Altersarmut litten. Von ihnen gibt es immer mehr in Deutschland, Baasner selbst ist einer von ihnen, 903 Euro Rente bekommt er, auch er ernährt sich von der Tafel.
Früher betrieb er mal eine Autowerkstatt, bis ihn ein Ärztefehler aus der Bahn warf. "Fünf Jahre lang war ich kein Mensch mehr." Seine Ehe ging kaputt. 1999 lernte er seine jetzige Frau Larisa kennen, die aus Kasachstan stammt und beim Extra-Markt als Putzfrau arbeitete. Sie erzählte ihm, wie unfassbar viel Ware in den Müllcontainern landete. Mit seinem alten Mercedes fuhren sie los, bettelten in Supermärkten, Bäckereien und Metzgereien um runzeliges Gemüse, altbackene Brötchen, abgelaufene Wurst.
Ihre Tafel sahen sie als Übergangslösung. Sie waren sich sicher, dass die Politiker vor Scham im Boden versinken würden, sobald sie sehen, dass im superreichen Deutschland Menschen für Almosen auf der Straße anstehen. Aber die Politiker besuchten sie, lobten, klopften Schultern, ließen sich mit den Helfern fotografieren, überreichten Baasner das Bundesverdienstkreuz am Bande. Und draußen wollten immer mehr Leute die Brösel der Überflussgesellschaft. 15 Tonnen Lebensmittel pro Tag lässt Baasner inzwischen verteilen. In den Jobcentern und Sozialämtern der Stadt raten Staatsdiener ihrer Klientel offen: "Geht zur Tafel, wenn das Geld nicht reicht." Die Mildtätigkeit ist längst systemrelevant.
Auf dem Hof kommen die ersten der zwölf Tafellaster von ihren Tagestouren zurück. Drei Helfer laden Currywürste aus, eingeschweißt, nur noch drei Tage haltbar, eine Fabrikspende diesmal. Sie stapeln sie auf Paletten, um sie ins Kühlhaus zu bringen. "Da können wir ja Grillparty machen", scherzt ein zahnloser Kunde. Die Helfer lachen nicht. Sie leben zwar selbst oft von den Gnadengaben, sehen sich aber eher auf der anderen Seite der Gesellschaft.
Bündel 500-Euro-Scheine im Sozialkaufhaus
Khalesa Suleiman starrt auf den Fleischberg. Sie stammt aus der Stadt Qamischli im kurdischen Nordosten Syriens, wo Krieg und Terror wüten. Eine Frau mit lila Kopftuch und schwarzem Mantel, vor sechs Monaten mit ihren drei Kindern geflüchtet. Ihr ganzes Geld habe sie Schleppern gegeben, erzählt sie. Sie weiß nicht einmal, auf welcher Route sie nach Deutschland kam. Türkei, Rumänien? "Wir waren die meiste Zeit in einem Lkw eingepfercht." Von der Tafel erfuhr sie schnell. In der Erstaufnahme überreichten ihr die Offiziellen Zettel mit der Wegbeschreibung.
Viele Ankömmlinge halten die Tafel für eine Art Staatsdiscounter, schließlich steht eine Reihe Einkaufswagen davor, es gibt Packtische, und man zahlt pauschal zwei Euro für einen Warenkorb. Baasner sagt, viele Hartz-IV-Empfänger dächten ähnlich. Offenbar ist die Tafel auch ein großes Missverständnis. "Die Kunden fordern alles, aber niemand fordert sie" , sagt Baasners Frau.
Khalesa Suleiman und zwei syrische Mitflüchtlinge kommen so oft wie möglich. Gemüse gibt es immer, sonst immer von allem zu wenig. "Milch und Eier sind selten", sagt Laila Dauud, eine der beiden. Und wenn, dann müsse man sich vorkämpfen, um etwas abzubekommen. Auch sie als Muslime haben heute Würste mit Schweinefleisch in ihren zerknitterten Lidl-Tüten. Mitnehmen, was geht, notfalls verkauft man es weiter.
Die Strategie der Tafelkunden wird immer trickreicher. "Manche haben jedes Familienmitglied einzeln als Kunden angemeldet, auch die sechs Kinder" , sagt Baasner. Dabei stehen jeder Familie nur zwei Kisten pro Woche zu. "Andere gehen auf Einkaufstour." Jeder, der eine "BüMA" vorlegt, eine "Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender", darf sich bei einer Tafel registrieren. Niemand kann prüfen, wer mehrfach angemeldet ist.
In der Ausgabehalle, wo ein großes Christuskreuz an der Wand hängt, versucht Karen Mittelstädt hinter ihrer kleinen Empfangstheke, irgendwie die Übersicht zu behalten. Die 29-Jährige kontrolliert wie eine Zollbeamtin am Flughafen immer neue Gesichter, mustert BüMAs und Hartz-IV-Bescheide, kassiert die zwei Euro, verhandelt in Deutsch, Englisch, Russisch. "Auch mal wieder hier?", sagt sie zu einer alleinerziehenden Mutter. "Immer wieder gern!", antwortet die.
Die Halle ist die Antithese der Glitzerkonsumwelt. Neonlicht, Betonboden, es riecht nach Biotonne, die Kunden schleichen wie ein Flüchtlingstreck durch das Spalier aus grünen Kisten. Sie müssen nehmen, was ihnen die Helfer reichen. Karen Mittelstädt ist hier mit großem Herzen angetreten. Sie hat Eventmarketing studiert und einen Agenturjob gekündigt, um bei der Tafel anzuheuern: "Ich wollte für niemanden arbeiten, der sich einfach nur die Taschen vollstopft. Ich wollte lieber helfen, helfen, helfen." Aber wer verdient Hilfe und wer nicht? Die Welt am unteren Rand der Gesellschaft ist nicht schwarz-weiß. Das erfährt sie jeden Tag. Schon mehrfach haben Asylsuchende nebenan im Sozialkaufhaus ein gummigeschnürtes Bündel 500-Euro-Scheine aus der Tasche gezogen, um Schuhe oder Kleidung für 50 Cent zu bezahlen. Wie muss eine Tafel handeln, wenn die Formel "Flüchtling gleich arm" nicht stimmt? Karen Mittelstädt hat darauf keine Antwort gefunden.
Wattenscheid, das ist typisch Pott. Zwischen den Zechen und Stahlfabriken mischten sich schon immer Arbeiter und Ausländer. Wolfgang Latzel kommt von hier. Ein Schlacks mit dünnem Haar, der in einem viel zu großen Anorak steckt. Der 65-Jährige schmiss in der Jugend seine Kaufmannslehre und konnte sich seitdem nie eigenständig versorgen. "Hab mich so durchs Leben geschlagen" , sagt er. Nun muss er seine depressive Frau mit durchbringen. Er schwenkt ein dickes Paket Currywürste. War gut heute. Bislang enthielt eine Tafelkiste Waren im Wert von 60 bis 80 Euro. Nun gibt es Woche für Woche weniger zu verteilen. "Wir werden wohl bald in Existenznot kommen", sagt er.
Insgesamt versorgen die gut 900 Tafeln in Deutschland fast 1,8 Millionen Menschen, unter ihnen 250.000 Flüchtlinge. Es gab Meldungen über Rangeleien und Tumulte, einige Tafeln haben die Abgabemengen rationiert, jeder erhielt weniger. Der Bundesverband sah sich gezwungen, auf seiner Homepage einen Hinweis zu schreiben, dass alle versorgt werden, nicht nur Flüchtlinge. Das System ächzt.
Die Tafel lockt Bluthunde an
Die Baasners fühlen sich vom Staat allein gelassen, eigentlich genau wie ihre Kunden. Oft diskutieren sie mit den anderen Tafelvorständen, was sie tun sollen. Protest? Einen Sternmarsch zum Rathaus? Streiken? Larisa Baasner würde am liebsten sämtliche arbeitsfähigen Hartz-IV-Empfänger vom Hof jagen und nur noch Alte, Behinderte, Alleinerziehende und arme Flüchtlinge bedienen: "Dass viele junge Leute nicht arbeiten wollen und die Politiker dagegen nichts tun, macht mich krank. Wir unterstützen Menschen dabei, sich zu ruinieren!" Die Anwälte haben von rigorosen Schritten abgeraten - wegen der satzungsgemäßen Mildtätigkeit.
Es geht gegen Mittag, und noch immer reißt der Strom der Hilfesuchenden nicht ab. Vor dem Tor zum Hof stehen Helfer und prüfen wie Türsteher jeden, der Einlass begehrt. Einer hat "H A S S" auf seine Finger tätowiert. Ein Mercedes-Kombi nähert sich. "Hey!", schreit einer der Helfer und streckt die Faust, da dreht der Wagen ab. "Wir kennen die alle", sagt er. Auch die Mercedes-Insassen, die bei den Tafeln der Region abräumen und die Ware dann auf Wochenmärkten verhökern.
Die Tafel lockt immer mehr Bluthunde an, die noch dort, wo es nach Kompost und Omas Möbeln riecht, Beute wittern. Sechsmal wurde schon ins angeschlossene Sozialkaufhaus eingebrochen. Zwei "Knackis", wie Baasner sie nennt, öffneten nachts den Tresor und raubten den Beutel mit den Zwei-Euro-Stücken von der Lebensmittelausgabe. Fast 3000 Euro. Dabei arbeiteten die beiden selbst bei der Tafel, als 1,50-Euro-Jobber.
Auf der Rampe steht eine grüne Kiste, randvoll mit Ware. Die Baasners greifen sie und packen sie in ihren Lieferwagen. Sie müssen auf Hausbesuch. "Viele Alte trauen sich nicht mehr zu uns" , sagt Baasner. "Die können wir nicht im Stich lassen." Keine fünf Minuten entfernt klingeln sie bei Dieter Zemann, einem Zweimeterkerl in Filzpantoffeln. Er steht gekrümmt in der Küche seiner Zweiraumwohnung. Seine Krücken drücken sich in den Linoleumboden mit dem Parkettmuster. Er erzählt von seinem Leben auf der Achterbahn. Eigentlich, sagt er, hat es vielversprechend begonnen. Mit 14 in die Lehre, Chemielaborant, dann Techniker, 30 Jahre Krupp, Edelstahlproduktion. Liebe, Hochzeit, zwei stramme Kinder. Doch die Ehe zerbrach, zwei weitere scheiterten. Dann Diabetes, die Wirbelsäule verspannte sich ("Platte hinten rein, zwei Schrauben"). Die Achterbahn stürzte ein letztes Mal herab und blieb unten stehen. Zemann verlor den Arbeitsplatz, landete bei Hartz IV. Und nun die Minirente. "20 Euro über dem Sozialsatz nach 40 Jahren Vollerwerb. Ist dat nich traurig?"
"So, nun nehmt mal", sagt er nach ein paar Sekunden. Er hat Kaffee gekocht, was für seinen 64 Jahre alten Körper einen Balanceakt bedeutet. Heute ist ein Festtag, Obst, Gemüse, ein bisschen Süßes, eine Packung Wickie-Salami und natürlich Currywurst. Zemann sackt in seinen Toilettenstuhl, seine zwei Küchenstühle überlässt er den Gästen. "Wenn et die Tafel nicht gäbe", sagt er, "dann wär ich wohl schon nich mehr." Er sagt, er fahre nicht mehr dorthin, weil er fürchtet, im Gerangel um die Lebensmittel zu stürzen und nicht mehr hochzukommen.
Auf dem Rückweg hängt Manfred Baasner seinen Gedanken nach. Was, wenn er sein Reich einfach dichtmachen würde? Als Zeichen gegen den sozialen Irrsinn. Doch dann denkt er an Menschen wie Zemann. An am Leben Gescheiterte wie Latzel. Entwurzelte wie die Syrer. "Ich will über niemanden richten" , sagt er. "Soll ich denn auch noch blind werden, nur weil es die Politiker sind?"