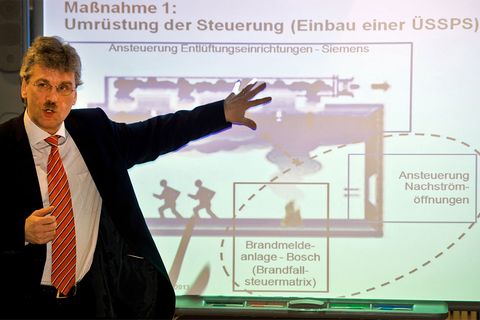Neulich saß Hartmut Mehdorn im Zug. Und vor ihm saß einer, der wollte telefonieren. Aber: kein Empfang. "Scheißbahn!", brüllte der Mann. Mehdorn beugte sich vor: "Mein Herr, am nächsten Wagen ist ein Schild mit Handy drauf. Wenn Sie da hingehen würden. Und schimpfen Sie nicht auf die Bahn, schimpfen Sie auf die Telekom."
Da gibt es also einen Bahnchef in Deutschland, der nicht nur aussieht wie ein Schaffner, sondern sich auch noch so benimmt, und zwar wie ein sehr schlecht gelaunter Schaffner. Einen Manager, der nicht in Talkshows hockt und an der Weltlage mäkelt, sondern an seinen Kunden. Einen irgendwie ständig aufgeregt wirkenden Mann mit quadratischem Schädel und heiserer Stimme, der sich mit allen anlegt, die "nur auf der Bahn rumhauen, weil sie mal wieder in die Zeitung wollen".
Wenn Sie auch mal Mehdorn-ärgere-dich spielen wollen mit dem Mann, den sie bei der Bahn "Rambo" nennen oder "Rumpelstilzchen" oder "Napoleon", mit dem monatlichen Schlusslicht des "Financial Times"-Managerbarometers, dann sollten Sie mit ihm und der Lufthansa von Berlin nach Frankfurt fliegen. Und ihn fragen, warum er sich von der Konkurrenz transportieren lässt statt von seinem ICE Sprinter. Mehdorn reagiere "regelmäßig genervt", behauptet ein Augenzeuge auf der Internetseite www.promisichtung.de. Viel naheliegender wäre allerdings die Frage: Herr Mehdorn, warum schmeißen Sie Ihren Job nicht einfach hin? Denn erstens hat Mehdorn, 61, in seinem Leben genug Millionen verdient, um den Rest davon mit Golfspielen, gutem Essen, Biografie schreiben oder zur Abwechslung mal mit Frau und Kindern herumzubringen. Zweitens könnte er viel mehr Geld verdienen bei einem viel angenehmeren, ihm mehr Respekt verschaffenden Job als ausgerechnet bei diesem, drittens, "Mörderjob", wie er ihn manchmal nennt und der ihm so offensichtlich die Laune verdirbt. Kein Wunder: Schon Bahnfahren macht wenig Spaß. Unpünktlich, unfreundlich, unmöglich - mit mindestens einer dieser Vokabeln auf den Lippen ist fast jeder schon einmal aus dem Zug gestiegen. Hat Mehdorn nicht manchmal auch Lust, einfach auszusteigen?
Leider kann er mit der Frage nichts anfangen. "Ich bin kein Hinschmeißer", sagt Mehdorn und behauptet, seine Arbeit würde ihm "immer Spaß machen, Frustmomente kenn ich nicht". Da sitzt auf seinem feuerroten Leder-Chefstuhl ein Mann, der zehn Pfund zugenommen hat, seit er hier sitzt. Er trägt einen anthrazitfarbenen Anzug, ein weißes Hemd, an den Füßen Slipper. "Schauen Sie meine Hände an", sagt er und streckt beide vor: schwer, breit, stark. "Die können arbeiten." Eingekleidet wird Mehdorn von seiner Frau Hélène, die ihn jetzt "noch weniger sieht als früher. Aber sie hat noch nie gemeckert", sagt Mehdorn. Sie arbeitet stattdessen an ihrem Golf-Handicap und entnimmt der Zeitung, was ihr Mann so treibt.
Mehdorns Schreibtisch ist fast leer, vorn ein Schild: "No surprises." Soll wohl ein Witz sein, denn der Alltag des Bahnchefs beginnt in der Regel mit Überraschungen und endet mit ihnen, und die schlimmsten überfallen ihn, "wenn nachts das Telefon klingelt", sagt er. Dann ist ein schrecklicher Unfall passiert, so wie 2000, als Mehdorn neu bei der Bahn war, das Zugunglück von Brühl. Das war, sagt er, sein bisher schlimmstes Erlebnis seit Amtsantritt. Das zweitschlimmste war, als er mit 220 Sachen vorn in der Lok mitfuhr und am Ende einer Kurve eine Frau auf ihrem Mofa vor der ICE-Schnauze über die Gleise tuckerte. Es kann so viel passieren in seinem 36.000-Kilometer-Schienen-Universum, in dem täglich 4,8 Millionen Passagiere unterwegs sind, aber er ist nicht Gott, sondern nur ein Manager, der versucht, ein Unternehmen zu managen, das nicht zu managen ist.
"Quatsch", sagt Mehdorn. "Wir kontrollieren das Unternehmen, wir haben es in der Hand, was passiert." Wenn er nicht gerade unterwegs sei, erzählt er, sitze er ab morgens um halb acht hier in seinem lichtdurchfluteten Büro ganz oben im Bahntower am Potsdamer Platz. Mittagessen entfällt oder besteht aus Buletten, und abends um halb elf sitzt er hier immer noch. Je nach Lage wird dann der Chauffeur für die Heimfahrt bestellt, oder er lässt eine Flasche Rotwein und enge Vertraute kommen, mit denen er die Probleme bespricht beziehungsweise runterspült. "Mein Alltag ist ja nicht so, dass ich da ein, zwei Probleme vor mir habe", sagt Mehdorn, "mein Kalender ist voll mit den unterschiedlichsten Problemen."
Die Probleme fangen bei den rund 1000 Selbstmördern pro Jahr an, die, mal nur von der technischen Seite betrachtet, das Unternehmen im Schnitt 2,7-mal täglich ausbremsen. Sie gehen weiter bei der Bearbeitung der 15 000 Briefe meist nicht erfreulichen Inhalts, die Mehdorn pro Jahr von seinen Kunden bekommt. Oder, um es mit Mehdorn zu sagen: "Die schweigende Mehrheit ist zufrieden."
Dann müssen von 250.000 Stellen rund 50.000 gestrichen werden, aber "sozial verträglich". Dafür müssen 50.000 neue Mitarbeiter nach dem Zukauf des Logistikunternehmens Stinnes integriert werden. Mal drohen Lokführer mit Streik, mal produzieren Zulieferer Schrottzüge wie den mit der Neigetechnik. Schnorren Junkies auf Bahnsteigen, schimpfen die Fahrgäste, lässt er die Junkies entfernen, protestieren Kirchen und Sozialverbände.
Mehdorns größtes Problem ist das Geld.
Die Bahn ist ein Milliarden Euro verschlingendes Monster, der ewige Sanierungsfall. Schon Ex-Kanzler Helmut Schmidt kam zu der Erkenntnis: Entweder leisten wir uns die Bundeswehr oder die Bundesbahn. Seitdem wurde viel Geld ausgegeben, dazu kam nach dem Mauer- noch ein Sanierungsfall: die Reichsbahn. 1993 war man kurz davor, sie stillzulegen, doch dann wurde unter Mehdorns Vorvorgänger Heinz Dürr die Bahnreform eingeleitet. Daraus ist jetzt, zehn Jahre und mehr als 70 Milliarden Euro später, die "Offensive Bahn" geworden. Für den Steuerzahler ein Grund, langsam echt sauer zu werden. Für Mehdorn ein Anlass, "zehn Jahre Deutsche Bahn AG" zu feiern. Und sich selbst. Allerdings nicht mit einer Sause für seine 250.000 Bahner. Stattdessen lud er eine Hand voll VIPs ins feine Berliner Hotel Ritz-Carlton, darunter Finanzminister Hans Eichel, nach wie vor Hauptsponsor der Bahn AG und ein Mann, von dem Mehdorn noch viel will - viel Geld.
Denn aus den zwei Mammutbehörden Reichs- und Bundesbahn, aus Unpünktlich-unfreundlich-unmöglich möchte Mehdorn ein "kundenorientiertes Service- und Mobilitätsunternehmen" machen. Am liebsten ein börsennotiertes, so wie es die Ex-Behörden Telekom und Post sind. Der Bundeskanzler findet die Idee gut, hat er im "Ritz" gesagt, und Mehdorn ist danach wie ein Flummi auf die Bühne gehüpft, Rührung in den Augen, Dankbarkeit in der Stimme. Rückenwind statt Gegenwind - diese Abwechslung tat gut.
Die Bahn an der Börse, das ist Mehdorns Traum. Platzt er, könnte er schnell alles hinschmeißen. Geht der Traum in Erfüllung, hat er sich ein unternehmerisches Denkmal gesetzt: Hartmut der Große. Das ist Mehdorns ganz persönliche Motivation und Mission. Jedenfalls sind es bestimmt nicht die geschätzt 650.000 Euro Jahresgehalt, die Mehdorn bekommt - so ein Lohn gilt in Managerkreisen als Peanuts. Lange hatte Mehdorn nach dem Job gelechzt, für den er seinen deutlich besser bezahlten Vorstandsvorsitz bei Heidelberger Druck schmiss. Offiziell, "weil ich was fürs Vaterland tun wollte". Tatsächlich aber wohl, weil Mehdorn zu den Männern gehört, die zu viel Geld haben, um arbeiten zu müssen, aber zu viel Ehrgeiz, um damit aufhören zu können. Und sich alles zutrauen.
Als ihm vor vier Jahren Bundeskanzler Schröder den "zweitverrücktesten Job der Nation" gab, wie er sich damals ausdrückte, hatte Mehdorn keine Ahnung vom Bahngeschäft. Er war ein fanatischer Flugzeugfreak und sehr erfolgreicher Airbus-Manager, ein hochbegabter Techniker, hemdsärmeliger Anpacker, ein Mann mit der Gabe, komplexe Probleme unter eine Überschrift zu setzen, ein Mutmacher mit Visionen und ein Denker mit der Wendigkeit einer MiG-29. Er jettete durch die Welt, manchmal auch nur von Hamburg nach Hannover, Hauptsache, geflogen. Dieser Mehdorn quetscht sich nun in eine Lok, freut sich, wenn man ihn "Mister Bahn" nennt, und jedes Mal, wenn er abheben will, muss er feststellen, dass das tonnenschwere Ding, in dem er sitzt, keine Flügel hat. Die Bahn "nimmt einen voll in Beschlag", sagt er. Das ist der Unterschied. Bei der Bahn geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern darum, nicht so oft stecken zu bleiben. Es geht nicht ums Mitreißen, sondern ums Aussitzen. Visionen? "In anderen Unternehmen können Sie als Visionär recht viele Leute motivieren", sagt Mehdorn. "Wenn aber die Leute, die im Güterbahnhof Maschen jeden Tag Hunderte Waggons zusammenstellen, was über Visionen lesen, sagen die: Der tickt nicht richtig." Tatsächlich kommen einem manche Ideen aus dem Bahntower wie Hirngespinste vor: Um künftigen Käufern von Bahnaktien anständige Renditen zu verschaffen, soll der Steuerzahler auch nach dem Börsengang das Unternehmen mit jährlich fünf Milliarden Euro sponsern. Die Bahn will ein moderner Dienstleister sein - doch die Mitarbeiter an den Schaltern verkaufen oftmals das Falsche. Mehdorn, der früher vor Ideen sprühte, sprüht jetzt Geifer. "Mehdorn gegen alle", überschrieb die "Süddeutsche Zeitung" einen Kommentar. Mehdorn wird der Bahn immer ähnlicher: unfreundlich, unmöglich, unpünktlich. Jedenfalls "erweist es sich jetzt als Fehler, dass das Unternehmen Bahn personifiziert wurde", sagt Norbert Hansen, Chef der Bahngewerkschaft Transnet. Jetzt, das ist, nachdem Mehdorn rund 30 Milliarden Euro Bundesgelder ausgegeben hat und immer noch Miese macht. Er hat unter großem Werbebrimborium ein Preissystem in den Sand gesetzt. Er hat das Versprechen, die Beratungsleistung der Bahn zu verbessern, nicht eingelöst, wie der neue Bahntest von stern und VCD zeigen. Er hat einen Aufsichtsratsvorsitzenden, einen Verkehrsminister, einen Vorstand und die Transrapidstrecke Hamburg-Berlin auf dem Gewissen. Im Jahr 2005, so hatte er versprochen, gehe die Bahn an die Börse - daraus wird nichts. Die Umsätze im Zug-Fernverkehr sind eingebrochen, der Güterverkehr nutzt nach wie vor die Straßen.
Auf der anderen Seite der Bilanz stehen viele Kippen-freie Bahnhöfe mit Raucherstationen, eine Pünktlichkeitsquote laut Bahntest von 91 Prozent, und viele Zugbegleiter wirken, als hätten sie ein Freundlichkeitstraining hinter sich. Sogar dem Bundeskanzler sind die Leute schon aufgefallen, die ihm zwischen Berlin und Hannover "so freundlich Kaffee anbieten - über die Preise wollen wir mal nicht reden".
Trotzdem: insgesamt eine magere Bilanz.
Für so wenig Gehalt hat er noch nie so viel Häme eingesteckt. "Das Problem Bahn ist erst gelöst, wenn der Vorstandsvorsitzende nicht Mehdorn heißt", verlautbart zum Beispiel der Bahnkenner der FDP, Horst Friedrich. Aktionismus und Großmannssucht unterstellt ihm das "Manager-Magazin". Und in einer höher gelegenen Bahntower-Etage stammtischt einer: "Der hat als Manager einfach keine Eier in der Hose." Rumpelstilzchens Reaktion: Das "Manager-Magazin" bekommt einen beleidigten Brief, gegen Horst Friedrich läuft sowieso schon eine Klage, und wer nicht mit Mehdorn gehen will, wird gegangen. So ähnlich ist es gelaufen, als er im vergangenen Frühjahr Hans-Gustav Koch und Anna Brunotte feuerte, das Pärchen, das sich das gefloppte Preissystem ausgedacht hatte. Und deren Chef Christoph Franz, bis zum Rauswurf Mehdorns Lieblingsvorstand, gleich mit. Andere hätten sich selbst entlassen, doch Mehdorn ("Wir sind kein Mädchenpensionat, und ich habe keinen Diplomatenpass") verlängerte seinen Vertrag bis 2008.
Er hat noch viel vor: "Erstens - Sanieren: Kosten runter, schlank werden. Zweitens - Leisten: pünktlich und sauber werden, Koffer raus- und reintragen, freundlich lächeln. Drittens - Wachsen: mehr Kunden, mehr Fracht, mehr Geschäft". Von einer "Reisekette" träumt er, die Bahncard soll zu einer Allround-Mobilitätskarte ausgebaut werden, gültig in allen S-, U-Bahnen und Bussen. Tanken, telefonieren und sogar Autos mieten soll man mit ihr können.
Hochfliegende Pläne, sagen Kritiker, verweisen auf 1995, als die zur Kreditkarte aufgerüstete Bahncard einging, und hoffen, dass die Mobilitätskarte Mehdorns Untergang wird. Er habe schon einige Fehler gemacht, zu viele jedenfalls, um erneut nur Bauern opfern zu können. Die Hoffnung ist ziemlich vage. "Der ist kein Amateurboxer, der nur drei Runden geht", sagt der Bahn-Marketingvorstand Klaus Daubertshäuser, kürzlich von Mehdorn durch die Installation eines neuen Marketingmanagers enteiert. "Mehdorn geht 15 Runden. Der steht von morgens bis abends unter Dampf. Manchmal frage ich mich: Wo hat der seinen Tank?" Mit beängstigender Stärke reagiere er auf Niederlagen. Jedenfalls hätten sich schon einige sehr gewundert, die zunächst gemeint hatten: Den muss man jetzt aufrichten.
Noch mehr wundern müssen sich allerdings diejenigen, die Mehdorns Ideen mit einem "Das geht nicht" begegnen. So etwas geht bei Mehdorn absolut nicht. "Never give up", lautet sein Manager-Credo. Und: "Ich bin nie zufrieden, ich war nie geduldig und bin es heute nicht."
Mit dieser Arbeitseinstellung
biss sich Mehdorn, Sohn eines kleinen Fabrikanten für Kunststoffspritzgussteile, durch seine Karriere. Die wichtigste und härteste Lektion verpasste ihm Jürgen Schrempp, als er ihm 1995 Manfred Bischoff als Dasa-Chef vor die Nase setzte - Mehdorn hatte sich schon auf dem Chefsessel gesehen. Er kündigte, baute den Mittelständler Heidelberger Druck zu einem internationalen börsennotierten Konzern aus.
Aber man braucht kein Psychologiestudium, um zu verstehen, wie bedingungslos der stolze 1,74-Meter-Mann wieder ganz nach oben wollte, an die Macht. Das bedeutet für ihn Macht über möglichst viele Mitarbeiter. Die Lektion lautet: "Auf einem Misthaufen kann es nur einen Gockel geben." Je größer der Misthaufen, desto besser. "Die Bahn ist der größte Arbeitgeber Deutschlands", betont Mehdorn gern in seinen Reden.Verkehrsminister Kurt Bodewig und Aufsichtsratschef Dieter Vogel biss er weg. Sie wollten das Schienennetz aus der Bahn heraustrennen. Sprich, Mehdorns Misthaufen verkleinern.
Nur Jasager lasse er in seine Nähe, spottet ein Insider, Vorstand und Aufsichtsrat habe Mehdorn zu Abnickern zurechtgestutzt. Am wohlsten fühlt sich Mehdorn beim Bahn-Fußvolk. Er würde gern allen die Hand schütteln, aber er schafft nur einen Bruchteil an Stellwerkern, Zugbegleitern und Fahrkartenverkäuferinnen. Sein Reich ist so riesig, dass er für eine Rede vor den Führungskräften eine Halle von Musikantenstadl-Größe braucht. Mehdorn, dem selbst seine Feinde "großartige Motivationskräfte" zugestehen, zappelt redlich am Pult ("Wir wollen über 95 Prozent Pünktlichkeit! Wir wollen es müssen!"), aber schon ab Reihe drei rollen seine Zuhörer die Augen wie renitente Oberstufenschüler: Wetten, dass der es auch nicht schafft?
Eines der größten Probleme der Bahn
, sagt Transnet-Chef Hansen, sei "die Unternehmenskultur". Es werde zwar unten zur Kenntnis genommen, dass Mehdorn oben dicke Bretter bohre. Aber irgendwie kämen die Fehler und die anschließenden Verbesserungsvorschläge der Beschäftigten nicht oben im Bahntower an. Mehdorn hingegen beschwert sich über "mangelnde Selbstinitiative" und wünscht sich eine "Fehlerkultur: Wir müssen so weit kommen, dass jemand sich zu sagen traut: Seht mal her, hier hab ich Mist gebaut. Das ist nicht zu viel verlangt", sagt er. Genau der richtige Moment, um Mehdorn auf seinen "Mist" anzusprechen. Stehen Sie zu Ihren Niederlagen? "Niederlagen würde ich das nicht gleich nennen", sagt Mehdorn. Und was war mit dem Preissystem? "Einige haben einfach beschlossen: 'Das schießen wir kaputt.'" Mit Mehdorn über das Preissystem zu diskutieren ist so erquickend wie gegenüber strenggläubigen Christen die Jungfrauengeburt anzuzweifeln. Oder gegenüber Mehdorn an Mehdorn zu zweifeln. Warum meckern so viele an ihm rum? "Das sind Leute, die mich nicht kennen. Die wollen nur eines: mich verletzen."
Vielleicht ist Mehdorns größter Fehler seine größte Stärke: die völlig ungetrübte Eigenwahrnehmung. "Wenn es einen gibt, der es besser kann, muss man darüber reden", sagt er. "Ich sehe im Moment keinen, der meinen Job will."