Sie muss jetzt diese Fragen stellen, auch wenn es ihr schwer fällt. Katja Jährig (39) sitzt einer freundlichen, älteren Dame gegenüber. Helga Karge (87). An der Wand kleben Fotos von Mischlingshunden, auf einem Sessel streckt ein Kater die Pfoten aus. Pupfl.
"Pupfl" gehört praktisch das ganze Zimmer“, sagt Frau Karge. Sie sitzt auf einem Bett die Hände ruhen auf einer Decke, sie schmunzelt. Sie lebt seit vier Jahren im Pflegeheim und in diese tägliche Routine ist jetzt diese Katja Jährig eingebrochen, löchert sie mit Fragen. Wie das Essen schmeckt, ob sie immer eine Flasche Wasser auf den Nachttisch gestellt bekommt, ob sie selbst das Bett macht, wie die Pflegerinnen sie behandeln, ob sie sich schon mal beschwert hat, ob sie die Arme über die Schultern hoch heben kann (sie kann) oder ob sie mit Daumen und einzelnen Fingern ein O formen kann (kann sie auch).

"Ich muss Sie das jetzt fragen", sagt Katja Jährig. "Wie läuft das mit dem Stuhlgang?" Frau Karge zögert nicht lange und sagt: "Mein Hintern kennt die Uhr, er meldet sich jeden Morgen um zehn Uhr."
Pflege ist ein Kampf zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Der Besuch bei Frau Karge gehört zu einem großen Plan. Es geht darum herauszufinden, wie alte Menschen tatsächlich leben. Wie werden sie in den Heimen und von ambulanten Pflegediensten behandelt? Erhalten sie die richtigen Pillen, werden die Wunden versorgt, kümmern sich die Betreuer oder schieben sie die Menschen in eine Ecke, wo sie vor sich hindämmern.
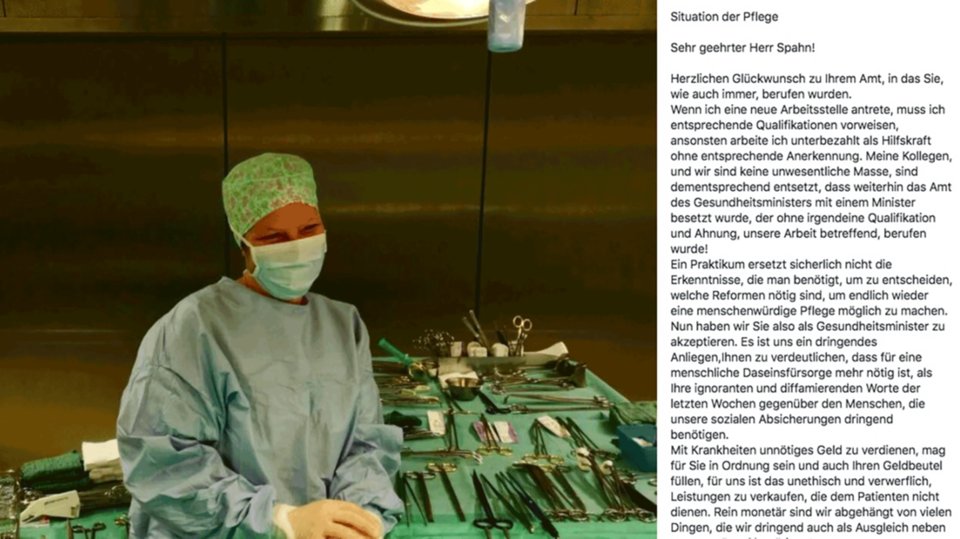
Es ist nicht leicht, diese Wahrheiten herauszufinden. Pflege ist etwas Intimes, es geht um körperliche Nähe, um eine Beziehung zwischen Hilfsbedürftigen und Pfleger. Außenstehende können da schwer hineinschauen. Und es geht ums Geld. Pflege ist ein Kampf zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen dem wie ein Mensch auf den letzten Metern des Lebens angemessen versorgt wird und was es kosten darf. In diesem Kampf gewinnt meist das Geld, nicht der Anspruch.
Katja Jährig will den Anspruch retten. Sie arbeitet beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) in Sachsen. Solche Dienste gibt es in der gesamten Bundesrepublik, sie prüfen jedes Jahr bundesweit 13.300 Heime und 12.800 Pflegedienste, mindestens einmal. Sie blicken hinter die Fassaden, wollen wissen, ob die Broschüren, mit den Bildern von strahlenden Alten und sonnendurchfluteten Zimmern, mehr sind als Wunschträume von Werbegraphikern. Sie rücken an mit Laptops und Listen, bleiben ein bis drei Tage, sind gefürchtet und werden geschmäht, wie das Ärzteblatt schreibt. Eine Art McKinsey des Gesundheitswesens, aber geschaffen von Norbert Blüm und bezahlt nach Tarifvertrag. Für einen Tag konnte sie der stern bei ihrer Arbeit begleiten, beim privaten Pflegeheim Vitaris im sächsischen Torgau, 50 Kilometer von Leipzig entfernt.
Die Prüfer wählen die Bewohner zufällig aus
Katja Jährig schaut sich die Essenräume an. An einem freistehenden Herd stehen Pflegerinnen und Bewohner beisammen, schwenken Pfannen, es riecht nach zerlassener Butter und Kartoffelbrei. Am Ende eines Flures trällern in einem Käfig zwei Kanarienvogel. An einer Wand hängen Sprüche zum Umgang mit Demenzpatienten: "Wenn ich DEMENT werde und schimpfe, dann gehe einen Schritt zurück von mir, so spüre ich, dass ich immer noch Eindruck machen kann."
Katja Jährig geht in ein schmales Zimmer, lässt sich ein Schrankfach zeigen, wo die Medikamente für Helga K. liegen. Das Haltbarkeitsdatum für die Augentropfen ist noch okay, die Spritzen sind es auch. Sie schaut, ob die Pillen in der täglichen Arzneimittelbox der verordneten Dosierung entsprechen. "Und wo ist die Sonntagsration?“ Die Schwester gibt sie ihr. Am Computer studiert sie den Behandlungsplan von Helga Karge. Wie oft wurde der Blutzucker gemessen? Hat es Hilfskraft oder eine Fachkraft gemacht? Wie hat sich das Körpergewicht entwickelt? Wie der Body-Mass-Index. Nach einer halben Stunde steht fest. Helga Karge wird gut gepflegt. Es gibt nichts zu beanstanden. Katja Jährig und ihre beiden Kollegen werden noch acht weitere Patienten ähnlich genau untersuchen,
Neun von 60 Bewohnern. Neun, die sie zufällig ausgewählt haben, von leichten bis schweren Fällen, von Pflegegrad Zwei bis Pflegegrad Fünf. Die Betroffenen selbst oder deren Angehörigen haben eingewilligt mitzumachen, und manche stimmten zu, dass der stern dabei sein darf.
"Wir können nicht für jeden Bewohner eine Pflegekraft abstellen"
Während Katja Jährig die Pillenpackungen checkt, sitzt ihr Kollege Holger Gasch (38) unterm Dach bei der Heimleiterin. Er fragt nach Dienstplänen, dem Hygiene-Konzept, danach, wie chronische Wunden gepflegt und Hilfskräfte eingewiesen werden.
"Wie läuft ihr Beschwerde-Management?"
"Wir haben überall im Haus Listen für Beschwerden ausgehängt."
"Kann ich die mal sehen?"
Die Heimleiterin holt ein paar Papiere aus einer Schublade.
"Da stehen nur Lobe drauf."
"Keine Beschwerden?"
Die Heimleiterin erzählt von einer Frau, die schwer pflegebedürftig war. Die Tochter hatte sie ins Heim gebracht. Die Frau war dement, sprach nur italienisch und die Tochter dachte, dass man sich im Heim so kümmern würde, wie sie es daheim täte. Doch das könne man nicht, sagt die Heimleiterin. "Wir können nicht für jeden Bewohner eine Pflegekraft abstellen." Holger Gasch nickt. Er sagt, dass manche Menschen falsche Vorstellungen über die Betreuung im Heim hätten.
Manche Kritik wirkt kleinkariert
Katja Jährig ist bei einer zweiten Patientin etwas aufgefallen. Die Frau bekam ein Schmerzmittel, aber es wurde nicht verzeichnet, welches Präparat es war, und wie viel sie bekam. Ein Dokumentationsfehler. Auch eine Kollegin von Katja Jährig berichtet von einem Mangel. Eine Frau wehrte sich ständig, ihre Augentropfen zu nehmen, das aber hätte der Pfleger dem Arzt mitteilen müssen, damit er dafür sorgt, dass die Frau ihre Tropfen auch nimmt.
Manche Kritik wirkt kleinkariert. Doch aus einzelnen Details können die Prüfer schnell erkennen, wie es im Heim zugeht. Erhält ein Bewohner laut Dokumentation die Medikamente falsch dosiert und zur falschen Zeit, deutet das auf ein schlampige Organisation hin. Wechselt das Personal ständig ebenfalls. Gasch erzählt von einem Heim, in dem ein Bewohner ein Zehntel seines Körpergewichts verloren hatte. "Das haben die Pfleger nicht einmal bemerkt, und Maßnahmen haben sie auch keine eingeleitet", sagt er.
Fast jedes Heim bekommt eine Note zwischen 1,2 und 1,5
Gasch, Jährig und hunderte Kollegen beim medizinischen Dienst wissen viel über die geprüften Heime. Sie schreiben detaillierte Berichte - manche über 120 Seiten lang - aber lesen dürfen sie nur wenige. Die Landesverbände der Pflegekassen, die Heimaufseher und die Heimleiter. Bewohner, Angehörige, Experten, Verbraucherschützer oder Journalisten nicht. Für sie gibt es nur Extrakte daraus, die Transparenzberichte. Aus ihnen entstand 2009 ein Pflegenotensystem, was aber mehr verschleiert als aufklärt. Denn schlechte Einrichtungen gibt es danach nicht. Fast jedes Heim hierzulande bekommt eine Note zwischen 1,2 und 1,5; wer etwa alte Leute schlecht pflegt, kann seine Note aufhübschen, wenn er ein gutes Essen kochen oder die Zimmer pflegt lässt. Auf dem Papier strahlen Deutschlands Heime.
Die Realität sieht anders aus. Da werden in Häusern mit "guten" Noten immer wieder alte Menschen gefunden, die in verdreckten Betten ausharren, die wochenlang nicht geduscht wurden oder sogar in ihrem eigenen Kot liegen. Wie groß die Unterschiede sind, zeigt auch der "Pflege-Report 2018", der von der AOK, der Berliner Charitè und der Hochschule Fulda herausgeben wird. Die Wissenschaftler untersuchten anhand von sechs Kriterien, wie Pflegebedürftige versorgt werden. In einem schlechten Heim bekommen sie dreimal so häufig Druckgeschwüre (Dekubitus) wie einem guten, haben sie zweieinhalb mal so oft eine Harnwegsinfektion, werden als Demenzkranker mit Antipsychotika vollgestopft, obwohl das oft unnötig ist, und sehen den Facharzt nur alle zwei Jahre, monieren die Autoren des "Pflege Report 2018".
Unklar ist auch, was aus der Arbeit der Kontrolleure folgt. Stellen sie erhebliche Mängel in fest, entscheiden die Landesverbände der Pflegekassen, was zu tun ist. Man muss vermuten, dass wenig geschieht. Holger Gasch prüft seit acht Jahren, doch daran dass ein Heim geschlossen wurde, kann er sich nicht erinnern. Katja Jährig berichtet von einem ambulanten Dienst, der so miserabel arbeitete, dass er dichtgemacht wurde. Dabei prüfen Gasch und Jährig zwischen 90 und 120 Häuser im Jahr.
Keiner weiß, wie oft Strafen verhängt werden
Andernorts sieht die Sache nicht besser aus. In Hamburg wurden zwischen 2014 und 2017 über 150 Pflegeheime und über 350 ambulante Dienste geprüft, teilte der Hamburger Senat auf Anfrage von AfD-Abgeordneten mit. Es gab 1380 Beschwerden, doch geschlossen wurde kein einziges Heim daraufhin. Laut des letzten Qualitätsberichts hat der Medizinischen Dienstes im Jahr 2016 13.304 Heime und 12.810 ambulante Dienste untersucht und ging 3003 Beschwerden nach. Doch über die Folgen erfährt man nichts. Wurden Heime geschlossen? Ambulanten Diensten gekündigt? Keine Ahnung. Im "5.Qualitätsbericht des MDS nach §114A ABS.& SGB XI" steht auf 131 Seiten dazu kein Wort. Bei gravierenden Mängeln kann die Heimaufsicht zwar dafür sorgen, dass ein Heim keine Pflegebedürftigen mehr aufnehmen darf, bis die Fehler behoben sind. Pflegekassen können ambulanten Diensten auch die Versorgung entziehen. Doch wie oft solche Strafen in der Praxis verhängt werden, weiß keiner. Es darf gerätselt werden.
Ein Haus hatte 350 Mängel
Fragt man Holger Gasch und Katja Jährig nach diesen Widersprüchen verweisen sie auf die Reform der Pflegenoten. Die Politik will das System umbauen und transparenter machen. Doch ob am Ende wirklich mehr Durchblick herrscht? Vorgesehen ist etwa, dass sich die Kontrolleure demnächst vor einer Prüfung anmelden müssen, anders als heute, wo sie in der Regel unangemeldet erscheinen. Welches Verfahren die Noten ersetzen soll, weiß auch keiner. Bislang ist nur geplant, dass sich die Menschen durch 20 Seiten, entweder auf Papier oder im Internet, quälen müssen, um sich über ein einziges Heim zu informieren.
Zurück nach Torgau. In dem Vitaris-Heim finden Gasch und Jährig am Ende nur einen Mängel, eben den fehlenden Hinweis an den Arzt, dass eine Patientin ihre Augentropfen ungern nimmt. Ein Fehler ist die Ausnahme, viele haben acht oder zehn, Spitzenreiter war ein Haus mit 350 Mängeln, sagt Katja Jährig.
Die Qualität hängt oft vom Personal ab
Es ist kurz nach 16 Uhr. Katja Jährig steht auf dem Flur, beobachtet, wie sich eine Pflegerin zu zwei alten Frauen an den Tisch setzt. "Dieses Heim wird sehr liebevoll geführt. Das ist leider nicht immer der Fall", sagt sie. Dann sind die Zimmer kahl, die Bewohner dürfen keine eigenen Bilder und Fotos aufhängen oder ihre Katze mitbringen. Das Essen wird aus einer Großküche angeliefert, hat unterwegs jeglichen Geschmack verloren, falls es überhaupt einen hatte. Ständige Ansprechpartner, sogenannte "Präsenzpflegekräfte" fehlen. Medikamente werden falsch verteilt, Hilfskräfte übernehmen Tätigkeiten, für die sie nicht ausgebildet worden sind.
Woran es liegt, ob ein Heim gut oder schlecht ist? "An den Menschen vor Ort, an der jeweiligen Heimleitung", sagt Katja Jährig. "Manchmal gibt es sogar große Unterschiede zwischen einzelnen Wohnbereichen eines Hauses. Es hängt immer davon, wie gut die Menschen sind, die da arbeiten."
Und vielleicht auch, wie viel Geld man mit einem Heim verdienen will. Vitaris ist ein gemeinnütziges Haus, es hat 60 Plätze, Heimleiterin Uta Kokola beschäftigt mit Voll- und Teilzeitstellen 61 Mitarbeiter. Der Eigentümer - das Kreiskrankenhaus Torgau - will offenbar nicht um jeden Preis Gewinn machen. Im vergangen Jahr lag der Umsatz des Pflegeheims laut Geschäftsbericht bei 5,6 Millionen Euro, der Jahresüberschuss bei 46.700 Euro. Macht eine Umsatzrendite von unter einem Prozent. Finanzinvestoren würden sich damit nicht zufrieden geben.

Lesen Sie in Teil drei der stern-Serie "Pflege in Not": Pfleger gelten als die neuen Helden des Alltags. Doch wie anstrengend ist ihr Job wirklich?












