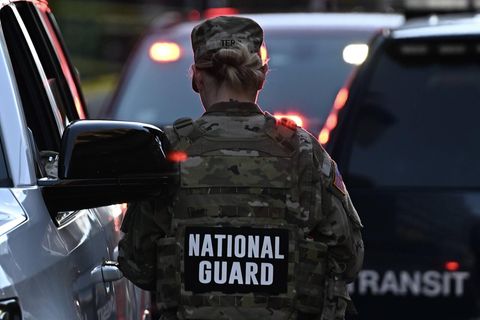Ist Afghanistan ein sicheres Herkunftsland? Ist es ethisch und rechtlich vertretbar, Geflüchtete dorthin abzuschieben, so wie Deutschland es seit 2016 in über 900 Fällen getan hat? Diese Frage polarisiert die Politik hierzulande seit Jahren. Unter jüngeren Social-Media-Nutzern aber hat das Thema bisher nur selten breite Aufmerksamkeit gefunden. Genau das möchte Mathias Herwix ändern. Sein Daten-Projekt „Back to War – Abschiebungen nach Afghanistan“ nimmt in der Kategorie „Investigation“ am Wettbewerb um den Nannen Preis 2021 teil.
Mathias Herwix erinnert sich noch genau daran, wie alles begann, im Sommer vor zwei Jahren. Damals besuchte der heute 28-Jährige die RTL-Journalistenschule in Köln. Gleichzeitig engagierte er sich in seiner Heimatstadt Hannover in der Flüchtlingsarbeit. Gemeinsam mit Freunden verschenkte er Willkommensboxen mit persönlichen Grüßen, Schreibmaterial und Spielen an Geflüchtete. Mitten hinein in diesen Sommer 2018 platzte der Skandal um eine Pressekonferenz des Bundesinnenministers. 69 Afghanen seien in ihre Heimat abgeschoben worden, und das ausgerechnet an seinem 69. Geburtstag, hatte Horst Seehofer gewitzelt.
„Ich hatte damals das Gefühl, dass viele Politiker*innen, die für Abschiebungen waren, keine Belege dafür geliefert haben, dass Afghanistan sicher ist“, sagt Herwix. Außerdem hatte er den Eindruck, die bisherige Berichterstattung zu Afghanistan entfaltete in Deutschland nicht die Wirkung, die er notwendig fand. „Statt die zwanzigste Reportage aus dem Land zu schreiben, wollte ich mich dem Thema anders nähern“, sagt der junge Reporter heute rückblickend.
Die Risiken der Abschiebungen anschaulich machen
Ein Datenjournalismus-Seminar, das er gerade im Rahmen seiner Ausbildung besucht hatte, inspirierte Herwix zu einer unkonventionellen Idee: Eine virtuelle Karte, die die aktuelle Gefährdungslage für jede afghanische Provinz dokumentiert, könnte die Risiken der Abschiebungen anschaulich machen. Wie man abstrakte Zahlen grafisch so aufbereitet, dass die Informationen für User unmittelbar zugänglich werden, hatte der angehende Journalist gerade gelernt. Das Afghanistan-Thema bot ihm die Möglichkeit, die neuen Fähigkeiten direkt in einem eigenen Projekt umzusetzen.

Je unsicherer eine afghanische Provinz, desto dunkler das Rot, in dem sie erscheint: das ist das Prinzip von „Back to War – Abschiebungen nach Afghanistan“, Herwix‘ Social-Media-Projekt. Nach dem Start 2018 entwickelt er es stetig weiter. Ab Mitte 2019 veröffentlicht er hier zusätzlich auf der Facebook-Seite des Projekts Wochen-Statistiken, verlinkt zu relevanten Artikeln aus anderen Medien und informiert über anstehende Abschiebungen. „Ich hatte das Gefühl, mit diesem Projekt etwas bewegen zu können“, sagt Herwix.
Sein Antrieb? Vor allem: Idealismus. Einen Auftraggeber, eine Finanzierung für „Back to War“ gibt es nicht.
Welchen Quellen kann man trauen?
Die Zahlen, die Herwix verwendet, recherchiert er bei staatlichen afghanischen Stellen und in internationalen Medien. Eine seiner wichtigsten Quellen ist der „Afgan War Casualty Report“ der „New York Times“. Darin listet der Kabuler Journalist Fahim Abed Monat für Monat, wie viele Menschen bei welchen ums Leben gekommen sind. Außerdem durchforstet Herwix regelmäßig die Website des internationalen afghanischen Fernsehsenders „Ariana News“. „Mir war wichtig, dass ich mich nur auf vertrauenswürdige Medien beziehe“, sagt er. Verlautbarungen der Taliban-Miliz verwendet er daher nicht.
Die „Back to War“ Karte aber erfasst nicht nur die Zahlen der Getöteten je Provinz, sondern auch sogenannte „unsichere Situationen“. Diese Rubrik dient Herwix beispielsweise dazu, auch Drohnen-Angriffe der US-Armee zu berücksichtigen oder Selbstmordattentate und Schießereien, zu denen exakte Opferzahlen oft fehlen. All diese Daten pflegt er in eine Excel-Tabelle ein, sie hat über 1100 Einträge. Allein für das Jahr 2019 bilanziert er 7347 Tote und 1186 unsichere Situationen. Rund zehn Stunden im Monat investiert Herwix zu Hochzeiten in das „Back to War“ Projekt.
Journalismus als Experimentierfeld
Hat der Aufwand sich gelohnt? „Eine schwierige Frage“, findet der Initiator. Einerseits hat die Facebook-Seite nur rund 150 Abonnenten. Andererseits sind seine Posts in Facebook-Gruppen mit Flüchtlingsbezug oft geteilt worden. Auch der Co-Direkter der renommierten Denkfabrik „Afghanistan Analysts Network“, Thomas Ruttig, habe seine Zahlen zu Abschiebungen aufgegriffen. „Insgesamt war es sicherlich nicht der riesige Erfolg, den ich mir gewünscht habe“, sagt Herwix. Trotzdem findet er, der Aufwand für „Back to War“ sei „völlig in Ordnung“ gewesen.
In seiner jungen journalistischen Laufbahn hat der 28-Jährige mit der eckigen Hornbrille und den hochgegelten Haaren schon häufig Mut zum Ausprobieren bewiesen. Nicht lange nachdenken, sondern Dinge einfach anpacken: das scheint ein Motto des Wahl-Kölners zu sein. „Journalismus mit Herz und Haltung – klingt banal, trifft aber vollkommen auf mich zu“ schreibt Herwix über sich auf seiner persönlichen Webseite. Vor Beginn seiner journalistischen Ausbildung hat er einen Freiwilligendienst in Kenia absolviert. Dem Land ist er seither eng verbunden. Diesen Sommer will er dort Workshops für lokale Journalisten organisieren.
Sein Idealismus zeigt sich auch an einem weiteren Social-Media-Projekt, das Herwix mit elf anderen Journalisten im März 2020 gestartet hat. Über den Instagram-Kanal „corona.report“ versorgten sie ihre 1800 Follower vier Monate lang mit Informationen rund um die beginnende Covid-19 Pandemie in Deutschland. Ende 2020 zeichnete die Landesanstalt für Medien NRW das Projekt mit einem Sonderpreis aus. „Die junge Redaktion weiß, wie man im Social Web kommuniziert und findet kreative Wege, um Informationen und Geschichten rund um Corona/Covid 19 zu kommunzieren“, heißt es in der Begründung der Jury.
Die Chancen der sozialen Medien
Außerdem betreibt Herwix ab 2019 das Instagram-Reportage-Kanal „tellical“, auf dem er kurze Videos im Hochformat veröffentlicht. Etwa über einen Sexualbegleiter, der alten Menschen intime Momente ermöglicht, über eine Schule in Kenia oder über Straßenhunde in Rumänien. Auch sein Afghanistan-Projekt „Back to War“ hat er über den „tellical“-Account beworben.
„Wir können in den sozialen Medien viel kreativer sein und sind nicht auf klassische Programmschemata festgelegt“, sagt Herwix. Auf Facebook, Instagram & Co. gehe es eben nicht immer nur darum, die große Masse zu erreichen. Man könne auch zielgerichtet Inhalte für bestimmte Nischen produzieren. „Das macht mir unglaublich Spaß“, sagt Herwix.

Afghanistan – und Fernsehgarten
Neben seinen eigenen Projekten hat er auch an digitalen Konzepten für verschiedene Fernsehshows mitgearbeitet, etwa für das "Vox"-Format „Survivor“, bei der 18 Menschen auf einer einsamen Insel überleben müssen, oder für den „ZDF-Fernsehgarten“, der sich – untypisch für Herwix – vor allem an eine ältere Zielgruppe richtet. Er sei ein Fan des sonntäglichen Dauerbrenners mit Andrea Kiewel, sagt er von sich.
„Back to War“, das Afghanistan-Projekt, ist derzeit aus Zeit- und Kostengründen pausiert. Herwix kann sich jedoch gut vorstellen, die Arbeit wieder aufzunehmen. Am liebsten in Kooperation mit einem größeren Medienpartner. Dann könnte er mit dem Format auch mehr Menschen erreichen, glaubt er.
Relevant bleibt das Thema Abschiebungen auf jeden Fall. Die jüngste Rückführungsflug nach Afghanistan – die 38. Sammelabschiebung dorthin seit Dezember 2016 – startete am Mittwochabend vom Hauptstadtflughafen BER. An Bord: 20 geflüchtete Afghanen.
Qualitätsjournalismus – wie wird der heutzutage eigentlich gemacht? Wie kommt ein Thema auf? Welche Quellen nutzen Reporter*innen für ihre Recherche? Welche Möglichkeiten bieten neue und traditionelle Medien? Welche Rolle spielt die Presse für eine lebendige, demokratische Gesellschaft? Um diese und andere Fragen zum modernen Journalismus kreist unsere neue Serie zum Wettbewerb um den Nannen Preis 2021, den der stern und das Verlagshaus Gruner + Jahr ausrichten. Im Lauf der kommenden Wochen werden wir hier eine Reihe journalistischer Arbeiten aus dem aktuellen Wettbewerb um die renommierteste Auszeichnung für deutschsprachigen Journalismus näher beleuchten.
Die Auswahl der Arbeiten, auf die wir an dieser Stelle in loser Folge eingehen, ist gänzlich unabhängig von der Arbeit der Jurys, die in geheimen Beratungen die Preisträger küren. Hier geht es nicht um die Frage: Welche Arbeit macht das Rennen? Sondern darum Sie, unser Publikum, teilhaben zu lassen an der beeindruckenden Vielfalt journalistischer Kreativität, die sich in den Einreichungen zum Nannen Preis 2021 zeigt.
Die anderen Folgen unserer Serie zu Arbeiten aus dem aktuellen Wettbewerb und weitere interessante Artikel rund um den Nannen Preis finden sie hier.
Ihr Nannen Preis Team