In Deutschland haben rund 367.000 Menschen die erste Dosis des Corona-Impfstoffs erhalten. Verabreicht wurde bislang nur das Mittel des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer, das als erster Impfstoff in der EU zugelassen worden war. Seit heute gibt es zudem grünes Licht für das Vakzin der US-Firma Moderna.
Bis Jahresende 2020 sollten in Deutschland 1,3 Millionen Impfdosen des Biontech-Vakzins ausgeliefert werden. Ab Neujahr folgen laut Bundesregierung jede Woche weitere 670.000 Dosen. Insgesamt wird für das erste Quartal 2021 mit 11 bis 13 Millionen Dosen gerechnet. Diese Menge wäre ausreichend, um rund 5,5 bis 6,5 Millionen Menschen gegen das Coronavirus zu immunisieren – pro Person braucht es zwei Impfstoffdosen, die mit einem Abstand von drei Wochen gegeben werden. Nach Angaben des Deutschen Städte- und Gemeindebundes leben in Deutschland jedoch allein 8,6 Millionen Menschen, die der höchsten Corona-Risikogruppe angehören, darunter Bewohner von Altenheimen, über 80-Jährige und medizinisches Personal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko. Sie sind es auch, die den Impfstoff vor allen anderen erhalten sollen.
Dass zu Beginn der Corona-Impfkampagne nicht ausreichend Impfstoff für alle Impfwilligen zur Verfügung stehen würde, war bereits seit längerem bekannt. Dennoch sorgte die Menge, die via Sammelauftrag der Europäischen Union (EU) geordert wurde, in den vergangenen Tagen für massive Kritik. Die EU habe eine zu geringe Menge des Biontech-Impfstoffs angefordert, argumentierten Kritiker. "Man musste den Impfstoff mit Monaten Vorlauf bestellen – und wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob der betreffende Impfstoff auch funktionieren würde", sagte dagegen der Berliner Virologe Christian Drosten am Wochenende zu der "Berliner Morgenpost".
Regierungssprecher Steffen Seibert verteidigte das gemeinsame Vorgehen der Bundesregierung mit den Partnern in der EU. "Wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg war und ist", so Seibert. Die EU hat neben dem Biontech-Pfizer-Vakzin noch bei weiteren Herstellern Impfdosen vorbestellt. Von dem heute zugelassenen Moderna-Impfstoff hat die EU insgesamt 160 Millionen Impfdosen geordert. Pro Person werden hier ebenfalls zwei Dosen mit zeitlichem Abstand gegeben.
Einig sind sich Experten darin, dass Hochrisikogruppen so schnell wie möglich geimpft werden sollten. Schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle sollen so verhindert werden. Doch wie geht das angesichts der derzeit knappen Ressourcen?
Ein pragmatischer Vorschlag kommt derweil aus Großbritannien. Dort erwägt die britische Regierung, zunächst möglichst vielen Menschen vorerst nur eine Impfdosis zu verabreichen und mit der zweiten Dosis bis zu zwölf Wochen zu warten. Der Hintergrund: In den Zulassungsstudien hatte der Biontech-Impfstoff bereits nach der ersten Gabe eine gute Wirksamkeit gezeigt. Nach der zweiten Dosis stieg diese weiter auf beachtliche 95 Prozent. Wird die Gabe der zweiten Dosis zeitlich verzögert, könnten mehr Menschen die Schutzwirkung der ersten Dosis erhalten, so die Hoffnung. Doch wie sinnvoll ist das geplante Vorgehen?
Zweite Impfung verzögern? Vorschlag erntet Zustimmung und Kritik
Die Zulassung des Impfstoffs in der EU basiert auf einer Studie, in der die zwei Dosen im Abstand von 19 bis 42 Tagen verabreicht wurden. Zu diesem Zeitraum liegen folglich entsprechende Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten vor. Wird die zweite Impfung über beispielsweise mehrere Monate verzögert, wäre dies eine sogenannte "Off-Label-Anwendung", also eine Anwendung eines Medikaments außerhalb seiner Zulassung. Kritiker argumentieren, dass durch die zeitliche Verzögerung die zweite Impfung als weniger wichtig erachtet werden könnte und Menschen womöglich den zweiten Impftermin ausfallen lassen könnten. Dabei sorgt erst die zweite Spritze laut Studiendaten für die hohe Wirkung von 95 Prozent. Unklar ist auch, wie lange die mögliche Schutzwirkung nach der ersten Immunisierung anhält – und wie stark der Impfschutz tatsächlich ausfällt.
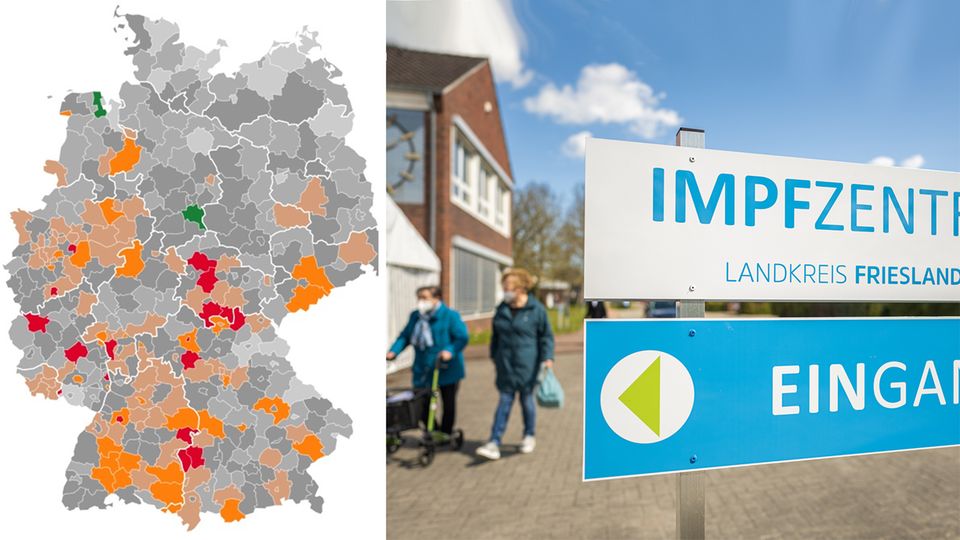
Leif-Erik Sander, Immunologe an der Berliner Charité, steht der Idee trotz der offenen Fragen grundsätzlich offen gegenüber. Mit der verzögerten zweiten Impfung "könnten wir schneller impfen und wertvolle Zeit im Kampf gegen Covid-19 gewinnen", so der Experte. Allerdings sei dies, wie er betont, nur eine vorübergehende Strategie. Auch sollte darauf geachtet werden, dass alle Geimpften im Verlauf eine zweite Impfung erhalten, um einen langfristigen Schutz zu gewährleisten, so Sander.
Ähnlich äußerte sich Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko), auf Anfrage des "Science Media Center". "Da der Abstand zwischen beiden Impfungen mit großer Wahrscheinlichkeit in weiten Grenzen variabel sein kann und der Schutz auch nach einer Impfung schon sehr gut ist, ist es durchaus überlegenswert bei Impfstoffmangel zunächst bevorzugt die erste Impfung zu verabreichen", so Mertens.
Selektionsdruck auf Virus steigt
Der US-Mikrobiologe Florian Krammer warnte dagegen vor den möglichen Folgen eines solchen Vorgehens bei hohen Infektionszahlen. Auf Twitter schrieb er, dass dadurch der Selektionsdruck auf das Virus erhöht werden könnte. Der Gedanke dahinter: Sind immer mehr Menschen durch eine erste Impfdosis teilweise immun, steigt der Druck auf das Virus sich durch Mutationen an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Neue Virus-Mutationen – ähnlich der gefährlichen Variante B.1.1.7, die zuerst in Großbritannien nachgewiesen wurde – könnten in der Folge entstehen und sich durchsetzen.
Er appellierte daher, das Zeitfenster bis zur Gabe der zweiten Impfung nur so lang wie nötig hinauszuzögern. Seien die Infektionszahlen niedrig, sei das von den Briten vorgeschlagene Zeitfenster von zwölf Wochen voraussichtlich "kein großes Problem", so Krammer. "Zirkuliert das Virus aber besonders stark (so wie derzeit in Großbritannien), ist das keine gute Idee."
Auch Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), äußerte sich zu der zeitlich verzögerten zweiten Impfung kürzlich eher zurückhaltend. Aus seiner Sicht sei die bisherige Vorgehensweise sehr vernünftig und richtig. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA sieht den Vorstoß der Briten derzeit ebenfalls eher skeptisch und verweist auf die Daten aus der Zulassungsstudie. Das US-amerikanische Pendant der EMA, die FDA, warnt indes sogar davor, von der vorgesehenen Verabreichung des Impfstoffs abzuweichen. Eine Verlängerung der Intervalle oder gar eine Reduzierung der Dosen könnten eine Gefahr für das öffentliche Gesundheitswesen darstellen, hieß es.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Möglichkeit einer verzögerten zweiten Impfung laut Medienberichten nun zumindest prüfen lassen. Demnach beauftragte er die an das Robert Koch-Institut (RKI) angegliederte Stiko mit der Sichtung entsprechender Daten. Der Ausgang? Bislang offen.
Sechs statt fünf Impfdosen – es liegt an der EMA
Tatsächlich ließe sich der Biontech-Impfstoff bereits jetzt effizienter nutzen. Wegen Überfüllung enthalten die Fläschchen zumeist sechs statt der vorgesehenen fünf Impfdosen. Die Nutzung der Extra-Dosis müsste allerdings zunächst von der EMA offiziell bewilligt werden - ein entsprechender Antrag wird derzeit geprüft. In den USA ist es Medizinern bereits erlaubt, die zusätzlichen Dosen zu verimpfen. Fällt die Entscheidung auch zeitnah in der EU, könnten in Deutschland bei sorgfältiger Entnahme bis zu 130.000 zusätzliche Impfstoff-Dosen in einer Woche zur Verfügung stehen.
Doch klar ist bereits jetzt: Selbst wenn das Prinzip "6 statt 5" greift, braucht es weitere Impfstoff-Zulassungen oder gesteigerte Produktionskapazitäten, um den großen Impfstoff-Bedarf der EU zeitnah zu decken. Dabei spielt auch eine geplante Produktionsstätte im hessischen Marburg eine zentrale Rolle. Hier könnte bereits im Frühjahr die Produktion des Biontech-Impfstoffs starten, stellte Bundeskanzlerin Angela Merkel jüngst in Aussicht. Das Ziel ist ambitioniert: Allein im ersten Halbjahr sollen dort – wenn alles nach Plan läuft – 250 Millionen Dosen Impfstoff produziert werden.
Quelle: Robert Koch-Institut / Bundesregierung








