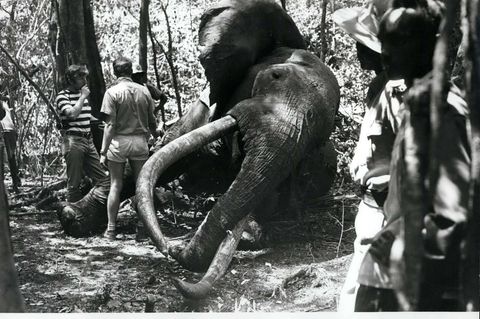Eine vielbemühte Metapher für den Umgang der Menschheit mit der Erderwärmung ist der Frosch im Kochtopf. Werde der Topf ganz allmählich erwärmt, so geht die Legende, nehme der Frosch das lange Zeit kaum wahr. Bis die tödliche Überhitzung es ihm irgendwann unmöglich mache, noch aus dem Bottich zu hüpfen. Ein zugespitztes Bild für den Klimawandel, der sich ebenfalls scheinbar langsam vollzieht und irgendwann doch dramatische Effekte hat.
Manche dieser Folgen könnten sogar eine sich selbst verstärkende Dynamik entwickeln: Viele Elemente des Erd- und Klimasystem gelten unter Experten und Expertinnen als so kritisch und labil, dass sie unter Umständen relativ schnell "kippen" und regelrechte Dominoeffekte im Klimasystem auslösen könnten – mit weitreichenden und eventuell irreversiblen Konsequenzen für Ökosysteme und Menschheit.
Der gerade erschienene "Global Tipping Points Report" listet diese neuralgischen "Kipppunkte" auf ("Tipping Points", auch Kippelemente genannt). Unter Federführung der britischen Universität Exeter haben daran mehr als 200 Forschende aus 26 Ländern gearbeitet, mitfinanziert wurde das Großprojekt vom "Bezos Earth Fund" des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Der Bericht ist die bisher wohl umfassendste Analyse zu Kipppunkten überhaupt.
Wie ein Schneeball, der eine Lawine auslöst
Die Gefahr bei Kipppunkten ist, dass sie sich nicht nur selbst verstärken, sondern auch miteinander interagieren, sich gegenseitig beschleunigen und anheizen können, so als würde ein Schneeball langsam über eine Hangkante rollen, immer mehr Fahrt aufnehmen, weiteren Schnee mit sich reißen und irgendwann eine Lawine auslösen.
25 Kippelemente im Erdsystem werden im Report genannt. Fünf davon könnten schon beim aktuellen Level der Erderwärmung kippen: die Eisschilde Grönlands und der Westantarktis, die subpolare Meeresströmung im Nordatlantik, Korallenriffe und Teile der Permafrost-Gebiete. Am schnellsten, nämlich innerhalb weniger Jahre, könnte es die Riffe treffen: "Schon heute, bei 1,2 Grad globaler Erwärmung, ist es wahrscheinlich, dass Korallenriffe in den Tropen kippen", erklärt Jonathan Donges vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), einer der Leitautoren des Berichts in einem Pressebriefing des Science Media Center Germany.
Sollte die globale Erwärmung im Schnitt 1,5 Grad erreichen – was sogar noch im Einklang mit den Zielen des Pariser Klima-Abkommens stünde – könnte ein großer Teil der Korallenriffe ganz absterben. Bei 1,5 Grad würden auch die großen Nadelwälder des Nordens, tropische Mangroven an den Küsten und Seegraswiesen in den Ozeanen destabilisiert und womöglich für immer geschädigt, bilanzieren die Autorinnen und Autoren. Ab etwa 2 Grad stünde auch noch der Amazonas-Regenwald am Abgrund und weite Teile des antarktischen Eisschildes könnten tauen.
500 Millionen Menschen wären Überflutungen ausgesetzt
Die Folgen wären katastrophal: Ein Abschmelzen des antarktischen Eisschildes könnte schon innerhalb dieses Jahrhunderts zum einem Meerspiegelanstieg von zwei Metern führen, wodurch rund 500 Millionen Menschen an den Küsten regelmäßigen Überflutungsereignissen ausgesetzt würden. Veränderungen der großen Meeresströmungen im Atlantik könnten das Wetter in Europa umkrempeln und in der Folge zu mehr Dürren und Ernteausfällen führen.
Auch soziale Kipppunkte drohen: Die dramatischen Folgen des Klimawandels bergen laut dem Report auch das Risiko, dass sich Gesellschaften polarisieren und radikalisieren, dass psychische Krankheiten zunehmen oder gewaltsamen Konflikte ausbrechen. Allerdings können gerade im gesellschaftlichen Bereich auf der anderen Seite auch positive Kippeffekte angestoßen werden: klimafreundliche Technologien und Verhaltensweisen, die sich ab einem bestimmten Punkt immer schneller verbreiten und die zum Beispiel helfen, Treibhausgasemissionen zu vermindern
"Soziale Kipppunkte können ähnlichen Mustern folgen wie Erdsystem-Kipppunkte, so dass es auch da Kaskaden oder Dominoeffekte geben kann", sagt Caroline Zimm vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse im österreichischen Laxenburg. Zimm ist leitende Autorin des Kapitels über soziale und positive Tipping Points.
Positivbeispiel Elektromobilität
So haben erneuerbare Energien dem Bericht zufolge ihren Kipppunkt erreicht, weil sie immer kosteneffizienter wurden und zum Teil schon günstiger als Öl, Gas oder Kohle zu haben sind – wichtigste Voraussetzung für ihre weitere Verbreitung. Ein weiteres Beispiel für einen positiven Dominoeffekt sei die Elektromobilität, so Zimm. Durch deren weitere Verbreitung gebe es eine höhere Nachfrage und mehr Innovationen in der Batterieforschung. "Das reduziert die Kosten und ist nicht nur für die E-Mobilität relevant, sondern auch für die erneuerbaren Energien und deren Speicherung." Auch Windparks sind beispielsweise auf effiziente und kompakte Speichertechnik angewiesen, um den erzeugten Strom für windarme Wetterlagen "zwischenzulagern".
Allerdings entstünden solche positiven Kippeffekte nicht "aus der Luft", so Zimm, sondern als Folge politischer Entscheidungen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Durchbruch der Elektromobilität in Norwegen. Seit den 1990er Jahren setzt die norwegische Regierung gezielt Anreize für den Kauf von E-Autos: Sie senkte die Mehrwertsteuer auf E-Mobile, subventionierte deren Kauf und baute über Jahre eine gut funktionierende Lade-Infrastruktur auf. Allein zwischen 2015 und 2022 wuchs die Zahl öffentlich zugänglicher Ladestellen im ganzen Land um mehr als 300 Prozent auf mehr als 24.000.
Es dauerte dann zwar noch bis 2016, bis der E-Mobil-Markt in Norwegen deutlich anzog. Doch dann explodierte er regelrecht. Zwar fahren auf Norwegens Straßen immer noch viel mehr Verbrenner als E-Autos. Doch Ende 2022 lag der Anteil der E-Autos an den Neuwagen bei stattlichen 80 Prozent, während es in Deutschland nur rund 25 Prozent waren. Norwegen erlebt gerade einen klassischen Dominoeffekt, angestoßen durch konsequente politische Weichenstellungen.
Das Konzept der Kipppunkte ist nicht unumstritten
Allerdings räumen die Autorinnen und Autoren des Global Reports ein, dass gerade bei den sozialen Kippeffekten und ihren Rückkopplungen mit dem Klimawandel noch viele Forschungsfragen offen sind. Auch das generelle Konzept der Kipppunkte ist nicht unumstritten. Ab wann sich komplexe System wie der Amazonas oder das Eis der Antarktis sich tatsächlich immer schneller verändern und inwiefern das tatsächlich unumkehrbar ist, lässt sich zurzeit nicht sicher vorhersagen.
Gerrit Lohmann forscht am Alfred-Wegener-Institut/Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und war nicht am aktuellen Bericht beteiligt. Er sieht – neben den vielen Unsicherheiten bei der Definition konkreter Kipppunkte – auch deren komplett in die Zukunft gerichteten Ansatz kritisch: "Ich finde das Konzept hilfreich, um langfristige Stabilitätseffekte zu verstehen. Aber auf der anderen Seite suggeriert das Konzept, dass man in Sicherheit lebt, wenn man unterhalb bestimmter Schwellenwerte ist".
Doch gerade in Bezug auf Extremwetter, etwa Trockenheit oder Überflutungen wie im Ahrtal müsse man dagegenhalten: "Wir sind eigentlich schon mittendrin im Klimawandel. Und die Extremwetterereignisse nehmen zu, obwohl wir noch keine so gravierenden Veränderungen wie den Verlust des antarktischen Inlandeises haben." Man müsse daher aufpassen bei der Kommunikation von Kipppunkten, "dass nicht der Eindruck entsteht, dass wir unter 2 Grad auf einem sicheren Weg sind."