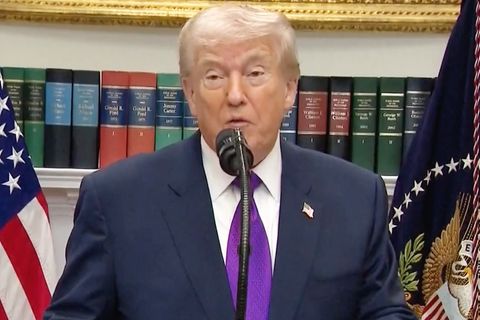Am Donnerstag beginnt die UN-Klimakonferenz (Cop28), ausgerechnet in Dubai. Ob die Weltgemeinschaft in einem Land, das vom Erdölexport lebt, zu nennenswerten Ergebnissen kommt, scheint fraglich. Aber auch hierzulande hat der monatelange Streit um das Heizungsgesetz gezeigt, wie sehr Maßnahmen zum Klimaschutz die Gemüter bewegen, Parteien gegeneinander aufbringen und auch zur Stimmungsmache benutzt werden.

Das Klimadashboard
Sie sind Wirtschaftswissenschaftlerin, Webdesigner, Biologinnen und Psychologen, sie sind jung – und sie alle eint ein Wunsch: den Klimawandel, seine Ursachen und seine Folgen besser verständlich zu machen. Mitte September starteten 16 Frauen und Männer des Vereins Klimadashboard die deutsche Website Klimadashboard.de. Im Bild: Johanna Kranz, Adrian Hiss und Cedric Carr.
Dabei spiegeln die erbitterten Diskussionen der Parteien oft gar nicht die tatsächliche Stimmung in der Bevölkerung wider. Eine aktuelle Analyse kombiniert erstmals Umfragen zu Klimaschutzmaßnahmen, die zwischen 2017 und 2021 durchgeführt wurden, mit Daten aus der letzten Volkszählung in Deutschland.
Auf dieser Basis entwickelte das Klimadashboard, ein Verein junger Wissenschaftler, Psychologen und Webdesigner (siehe Kasten), interaktive Deutschlandkarten. "Anhand der Karten lässt sich zeigen, wie groß die Akzeptanz der klimapolitischen Maßnahmen auf regionaler Ebene tatsächlich ist", sagt die Biologiedidaktikerin Johanna Kranz vom Klimadashboard. Unterschiede zwischen Städtern und Landbevölkerung sind ziemlich exakt ausdifferenziert.
Zustimmung zu verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen
Eine Analyse verknüpft erstmals die Daten aus Umfragen zu Klimaschutzmaßnahmen mit denen der letzten Volkszählung (Zensus). Daraus lassen sich die Zustimmungsdaten auf den Landkreis genau berechnen.
Politiker haben bei der Klimawende bisher vor allem auf technische Daten geblickt. "Aber die entscheidenden Fragen lauten: Wozu sind die Menschen überhaupt bereit? Was sind ihre Hoffnungen und Erwartungen an die Politik? Was sind ihre Ängste?", sagt Kranz. Aus den Antworten auf diese Fragen könnten Politiker praktische Rückschlüsse ziehen und besser planen, wo ihre Kommunikationsstrategien ansetzen und noch mehr Aufklärungsarbeit notwendig ist.
Fast alle Deutschen sind für Solaranlagen auf dem Dach
Die Analyse umfasst 26 Klimaschutzmaßnahmen aus dem Bereichen Wärme, Transport und Energie, mit sehr unterschiedlichen Zustimmungsraten – im ganzen Land und regional. So befürworteten in der Umfrage aus dem Jahr 2021 lediglich 26 Prozent der Bundesbürger die Abschaffung des Verbrennermotors. 49 Prozent votierten für ein Tempolimit auf Autobahnen – aber 91 Prozent sprachen sich für Solaranlagen auf Hausdächern aus.
Auch für den Ausbau der Windenergie an Land gibt es eine überraschend hohe Akzeptanz, 75 Prozent der Bundesbürger stimmen zu. Selbst in Bayern, wo bislang auf die Fläche bezogen nur sehr wenige Windräder stehen, liegt die Zustimmungsquote in den meisten Landkreisen und Städten bei etwa 70 Prozent.
Zustimmung zur Windenergie
Die Windenergie an Land ist längst nicht so umstritten wie vielfach vermutet. Seit Jahren steigt die Quote der Befürworter. Selbst in Bayern, wo der Ausbau – auch politisch gewollt – stockt, sind mehr als zwei Drittel der Bürger von Windkraft überzeugt.
"In der Klimaberichterstattung stehen meist die vermeintlichen Differenzen zwischen Politik und den Menschen im Fokus", sagt Kranz. Dabei gibt es bei manchen Themen offenbar eine viel größere Zustimmung in der Bevölkerung, als der oder die Einzelne vermuten würde. Es sei wichtig, diese Daten in die große Diskussion einzubringen. Die neue Transparenz hilft den Bürgern einer Region, für sich einzuschätzen: Wo liegt die soziale Norm bei der Frage – und bewege ich mich darin?
"Soziale Einstellung und gesellschaftliche Normen können sich ändern"
Interessant ist auch die Entwicklung, betrachtet auf die Jahre. Im bayerischen Eichstätt etwa stieg die Quote der Windkraftbefürworter zwischen 2017 und 2021 von 44 auf 70 Prozent. Ein Trend, der sich auch in anderen bayerischen Städten und Gemeinden abzeichnet. "Man sieht, Wandel ist möglich. Soziale Einstellung und gesellschaftliche Normen können sich ändern", sagt Kranz.
Doch die Politik sollte sich nicht verleiten lassen, nur nach den "low hanging fruits" zu greifen, so die Biologiedidaktikerin. Also nicht nur jene Maßnahmen umzusetzen, zu denen die Gesellschaft ohnehin bereit sei. Unpopuläre Vorhaben müssten durch eine bessere Aufklärungsarbeit flankiert werden, etwa das Tempolimit auf Autobahnen: Was bringt es für die Reduktion des CO2-Ausstoßes im Verkehrssektor? Und wie steht das im Zusammenhang mit den Klimaschutzzielen der Regierung? "Die Politik muss aber auch klarmachen, was es bedeutet, wenn eine Maßnahme wie das Gebäudeenergiegesetz nicht richtig umgesetzt wird", sagt Kranz.