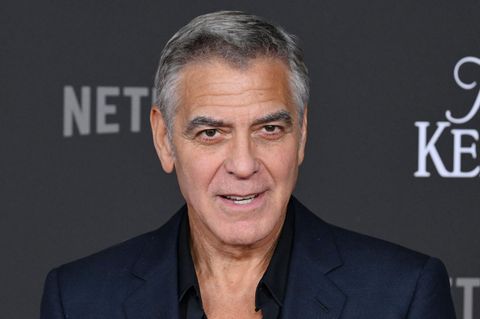Lavendelfelder, Olivenhaine und Weinberge - malerisch breitet sich die Landschaft der Provence im Südosten Frankreichs aus. "Das Schönste bei weitem", schwärmte Rainer Maria Rilke, als er im Jahre 1911 auf einer Reise von Paris nach Bologna das hügelige Fleckchen Erde durchquerte.
10 Milliarden Euro soll Iter kosten
Im vom Poeten besungenen und bei Touristen beliebten Terrain wird nun ein Monstrum errichtet. Eine gigantische Maschine, die einen alten Traum der Wissenschaftler wahr machen soll. Mit ihrer Hilfe wollen Forscher das Feuer der Sterne zähmen und auf der Erde nutzbar machen. Und damit eine fantastische Quelle erschließen, so die Verheißung der Experten, die für alle Zukunft den unersättlichen Hunger der Menschheit nach Energie stillen kann.
Nun gab es grünes Licht für das "größte Wissenschaftsprojekt seit der Internationalen Raumstation", wie Frankreichs Staatspräsident Jacques Chirac schwärmte. Im Pariser Elysée-Palast unterzeichneten die Partner ein Abkommen zur Finanzierung des Superkraftwerks - Vertreter Amerikas, Russlands, Chinas, Japans, Indiens, Südkoreas und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso. Geschätzte Kosten der Anlage und ihres Betriebes: 10 Milliarden Euro. Rund 460 Millionen werden aus Deutschland kommen.
Gebaut wird beim Örtchen Cadarach, wenige Kilometer nordöstlich von Aix-en-Provence, auf dem Gelände der französischen Atomenergiebehörde CEA. Die Vorbereitungen sind im Gange, vermutlich 2008 kann mit der Installation der Maschine begonnen werden. Nach der Fertigstellung in etwa zehn Jahren sollen 600 Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler zwei Jahrzehnte mit ihr arbeiten.
Treibstoff für Iter nahezu unerschöpflich vorhanden
"Iter" heißt die Anlage, eine Abkürzung für "International Thermonuclear Experimental Reactor". Die Apparatur ist 30 Meter hoch und hat einen Durchmesser von knapp 11 Metern. Hauptbestandteil ist eine torusförmige Brennkammer mit einem Volumen von 840 Kubikmetern. Darin wird Wasserstoffgas - berührungsfrei von einem Magnetfeld in der Schwebe gehalten - auf eine Temperatur erhitzt werden, gegenüber der selbst die Hölle wie ein kühles Plätzchen anmutet: gut 100 Millionen Grad. Dabei sollen die Wasserstoffatome - genauer: die Isotope Deuterium und Tritium - zu Heliumatomen verschmelzen. Diese Kernfusion setzt gewaltige Energiemengen frei; ein Prozess, der auf der Sonne und all den anderen Gestirnen im Weltall abläuft. Ein Kilogramm zu Helium verschmolzener Wasserstoff liefert so viel Energie wie 11 000 Tonnen verfeuerte Steinkohle. Und der Rohstoff ist in nahezu unerschöpflichen Mengen überall auf der Welt vorhanden.
Den Anstoß zum Bau des Fusionsreaktors gaben Gespräche, die bereits im Jahre 1985 der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow mit dem französischen Präsidenten François Mitterrand und dessen amerikanischem Amtskollegen Ronald Reagan führte. Daraufhin begannen am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching bei München die Planungen. Im Laufe der folgenden Jahre fanden sich die heute beteiligten Partnernationen zusammen. Mehrere Standorte wetteiferten erbittert um das Projekt, insbesondere das kerntechnische Industriezentrum Rokkasho in Nordjapan und die französische Atomenergiebehörde in Cadarache. Nach langwierigen Verhandlungen fiel im Juni vergangenen Jahres die Entscheidung für den Bauplatz in der Provence.
Kontrollierte Fusion ist komplex und schwierig
Iter muss nun vor allem zeigen, dass es physikalisch und technisch überhaupt möglich ist, durch Kernverschmelzung Energie zu gewinnen - bislang klappt das nur in der Theorie. So lautet die alles entscheidende Frage: Wird die Maschine wirklich funktionieren? Immerhin gibt es bereits Erfahrungen mit kleineren Reaktoren in aller Welt. Doch schon bei jenen Experimenten stellte sich stets aufs Neue heraus, wie ungemein komplex und schwierig der Prozess der kontrollierten Fusion ist.
Einer dieser Reaktoren ist der 1983 gestartete europäische JET, "Joint European Torus", nahe Oxford in Großbritannien. Immerhin gelang es Physikern dort erstmals überhaupt, ein Plasma, ein Gas aus Wasserstoffkernen, zu zünden. Doch trotz größter Anstrengungen schafften sie es nur für wenige Sekunden. Und dabei war der vermeintliche Stromspender nur ein Stromschlucker: In die kurze Wasserstoff-Fusion musste mehr Energie hineingesteckt werden als herauskam, lediglich 65 Prozent konnten zurückgewonnen werden. Deshalb fürchten Skeptiker, dass den Experimenten mit Iter ein ähnliches Schicksal widerfahren könnte und die Kosten von zehn Milliarden Euro dann sang- und klanglos in den Sand der Provence gesetzt wären.
Auch Iter produziert radioaktiven Abfall
Neben wissenschaftlicher Skepsis gibt es Umweltbedenken. Zwar gilt im Gegensatz zur Kernspaltung in herkömmlichen Atommeilern die Kernfusion als sicher, weil keine unkontrollierte Kettenreaktion stattfinden kann, also ein Super-GAU wie im ukrainischen Tschernobyl als prinzipiell unmöglich angesehen wird. Doch auch bei einem Fusionsreaktor werden die Wände und andere Komponenten im Laufe des Betriebes radioaktiv; die verstrahlten Teile müssen regelmäßig ersetzt und entsorgt werden.
Außerdem ist eine Brennstoffkomponente das radioaktive Wasserstoffisotop Tritium; es wird in Iter aus dem Element Lithium "erbrütet". "Man rechnet damit, dass in einem zukünftigen Fusionsreaktor jährlich zwei Gramm Tritium entweichen", sagt Martin Kalinowski, Direktor des Carl Friedrich von Weizsäcker-Zentrums für Naturwissenschaft und Friedensforschung der Uni Hamburg. "Die Emissionen würden im Normalbetrieb so hoch sein, dass die Strahlenschutzauflagen nur mit besonderen Maßnahmen - dem Bau eines 200 Meter hohen Kamins und der Einzäunung des Geländes im Umkreis von zwei Kilometern - einhaltbar sein werden."
Cadarache ist erdbebengefährdet
Speziell bei Iter könnte sich noch ein weiteres Problem einstellen. Cadarache liegt nahe einer tektonisch aktiven Bruchzone, unweit der Nahtstelle der eurasischen und der afrikanischen Platte. "Afrika drückt und schiebt", sagt Geologe Jacques Muller vom französischen Forschungsinstitut "Centre National de la Recherche Scientifique", der Boden sei hier "besonders instabil". Etwa alle einhundert Jahre rechnen die Forscher in dieser Gegend mit einem schweren Beben. Das bislang letzte ereignete sich im Jahre 1909 und hatte eine Stärke von 6,2 auf der Richterskala. 49 Bewohner der Region kamen ums Leben.
Ungeachtet aller Vorbehalte planen Fusionsforscher längst für die Zeit nach Iter. Sollte nämlich die Kernverschmelzung wirklich klappen, müssen Wege gefunden werden, die Energie auch zuverlässig, effektiv und sicher zu nutzen. "Um das Jahr 2025 herum muss die Entscheidung für ein Demonstrationskraftwerk fallen", sagt Professor Alexander Bradshaw, Direktor des Max-Planck-Institutes für Plasmaphysik. Es wird dann wie ein richtiges Werk Strom ans Netz liefern, aber nur eine experimentelle Energiefabrik sein. Bradshaw: "Erst wenn man genügend Erfahrungen gesammelt hat, kann man mit dem Bau des ersten kommerziellen Kraftwerkes beginnen. Das wird bis Mitte des Jahrhunderts dauern."