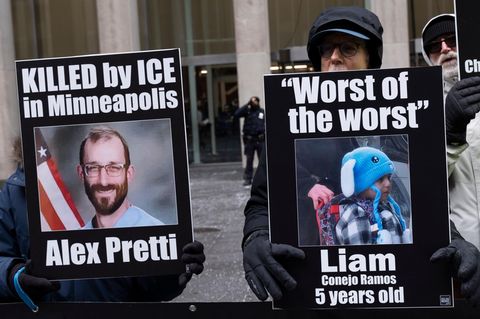Den diplomatischen Durchbruch zerschmetterte Lindsey Graham ohne viel Federlesen: "Das war eine verpasste Gelegenheit", wetterte der Senator aus South Carolina über den Deal zum iranischen Atomprogramm. "Wir hatten diese Jungs am Wickel", meinte der Republikaner am Montag im CNN-Interview. Doch was in der Nacht zum Sonntag in Genf beschlossen worden sei, räume dem Iran weiterhin "alle Mittel" zum Streben nach Nuklearwaffen ein.
In Washington sitzen die Zweifel tief. Daran ändert auch nichts, dass UN-Generalsekretär Ban Ki Moon die Genfer Atom-Vereinbarung schnell als möglichen Beginn eines "historischen Abkommens" lobte. Schon vor der Gesprächsrunde in Genf wollten US-Senatoren beider Lager schärfere Sanktionen gegen Teheran verhängen. Und auch nach dem Deal bleiben die Kritiker misstrauisch, wenn es um die Bewertung der Übereinkunft als Erfolg geht.
Das Problem: Der Text vom Wochenende gibt keine klare Antwort auf die Frage, ob dem Iran nun explizit und grundsätzlich das Recht eingeräumt wird, Uran anzureichern. Damit bleibe einer der wichtigsten Streitpunkte im jahrelangen Konflikt unbeantwortet, schreibt das Magazin "Foreign Policy", und fragt: "Haben die Vereinigten Staaten dem Iran gerade das Recht eingeräumt, Uran anzureichern?" Genau das behauptete am Sonntag auch Mike Rogers, Vorsitzender des Geheimdienst-Ausschusses im Abgeordnetenhaus. Außenminister John Kerry wies diesen Vorwurf von sich.
Jahrzehntelange Kultur des Misstrauens
Doch es sind nicht nur begriffliche Feinheiten, die den Argwohn einiger US-Politiker gegenüber dem Iran schüren. Beide Länder blicken auf eine jahrzehntelange Kultur des Misstrauens zurück, die 1953 mit dem Sturz des iranischen Ministerpräsidenten Mohammed Mossadegh begann. Die "Operation Ajax" - so der Codename des Putsches der Geheimdienste CIA und MI6 - war das erste Mal, dass die Vereinigten Staaten in dieser Region eine ausländische Regierung stürzten. Hintergrund waren der Kampf ums Öl und eine befürchtete drohende kommunistische Machtübernahme.
Unvergessen blieb auch der Morgen des 4. November 1979, als iranische Studenten im Zuge der Islamischen Revolution auf das Gelände der US-Botschaft in Teheran drängten und 52 Amerikaner als Geiseln nahmen. Mehr als drei Jahrzehnte lagen die diplomatischen Beziehungen seitdem auf Eis. Der achtjährige Golfkrieg und das umfassende Handelsembargo gegen den Iran 1995 vertieften das Misstrauen. Spätestens als George W. Bush den Iran als Teil der "Achse des Bösen" bezeichnete, war die Islamische Republik in den Augen vieler Amerikaner ein gefürchteter Widersacher.
Immer wieder - und bis heute - war es die Angst vor dem iranischen Streben nach Massenvernichtungswaffen, die Washington auf Abwehr schalten ließen. Zu groß ist die Angst, dass die Schrauben des Westens nun voreilig gelockert wurden. "Ich glaube, wir alle sehen es mit Skepsis", sagte Senator Bob Corker mit Blick auf den Deal vom Wochenende. Die iranische Taktik der "Vernebelung" müsse weiterhin hinterfragt werden, ließ der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, John Boehner, wissen - und warnte vor einem "cleveren Manöver" Teherans.
Willkommener Themenwechsel für Obama
Während die EU erste Schritte unternimmt, um einige Sanktionen fallenzulassen, rufen Senatoren beider Lager in Washington nach neuen Strafmaßnahmen. Präsident Barack Obama hatte führende Politiker vor den Gesprächen persönlich dazu gedrängt, dem Deal eine Chance zu geben. Doch Lindsey Graham stellte am Montag erneut klar, was die Kritiker wollen - die Uran-Anreicherung endgültig stoppen und nicht nur aussetzen.
Für Obama dürfte es dennoch ein höchst willkommener Themenwechsel sein. Nach wochenlanger Kritik an der Pannen-Webseite zu seiner Gesundheitsreform "Obamacare" und miserablen Umfragewerten kommt ihm ein außenpolitischer Erfolg wie das Abkommen mit Teheran gerade recht.