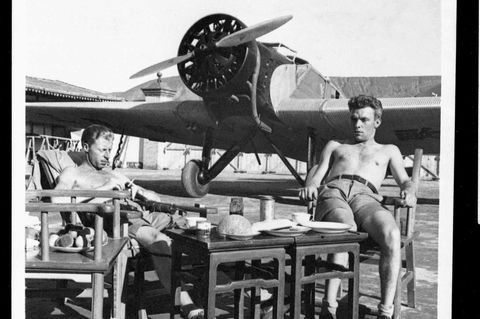Man kann niemals in das gleiche Shanghai eintauchen, die Stadt wandelt sich einfach zu schnell. Es ist bekannt, dass Bauern noch vor fünfzehn Jahren in Pudong an der Stelle Reis und Gemüse pflanzten, wo inzwischen einige der höchsten Gebäude der Welt aus dem Boden gewachsen sind. Mein Freund Jinglei hat in der Xu-Zhang-Straße Kindheit und Jugend verbracht, unweit vom Haus seines Onkels. Als wir den kürzlich besuchen wollten, hat Jinglei das Haus vor lauter neu gebauter Appartment-Blöcken und Läden nicht mehr gefunden, obwohl wir die Xu-Zhang-Straße zweimal abgefahren sind. Er hat seinen Onkel angerufen und sich versichern lassen, dass das Haus noch steht.
In so einem Moment
stellt sich das "Sandkorn-in-wandelnder-Düne-Gefühl" ein. Die Stadt spürt das und hat Déjà-vu-Phänomene geschaffen, die dieses Gefühl wieder auffangen. Mein Lieblings Déjà-vu ist das "Shanghai Baby"-Déjà-vu. Das ist der Titel eines auch ins Deutsche übersetzten Romans der Schriftstellerin Wei Hui, und gilt besonders bei Ausländern als Kult. "Ey, in Shanghai ist ja voll die Szene" sagen die und saufen sich durch alle Bars und Discos, die in dem Roman vorkommen: Durch den "Old China Hand Reading Club", durch die "Buddha Bar" in der Ausgehstraße Maoming und durch den "YY Club" in der Nanchang Lu.
Am Dienstag war ich mal wieder im YY Club. Da ist es echt nett. Die Wände sind mit dunklem Holz verkleidet, Kenny, der Besitzer, legt gerne Leonard Cohen und Bossa Nova auf und man kommt immer mit jemandem ins Gespräch. Diesmal mit einem nordirischen Broker aus Hongkong, einem Unternehmensberater aus Köln und Richard Gere. Doch, ich schwör's, da sitzt Richard Gere, raucht Gras und sagt immer wieder: "There are so many cool things in this town, man".
Der Kölner sagt, er wolle "sein Know-how als Schnittstelle zwischen Importeur und lokalem Abnehmer einbringen" und der Broker aus Hongkong erzählt, wie er die Wohnung einen Stock tiefer unter Wasser gesetzt hat, weil er Wäsche waschen wollte, aber die Leitungen zugefroren waren. Der Kölner fragt dann, wer hier einen bauen kann und Richard Gere sagt: "There are so many cool things in this town, man".
Und schließlich läuft das Gespräch unweigerlich auf den einen Punkt hinaus: "Sag mal, habt ihr eigentlich 'Shanghai Baby' gelesen?" Klar haben sie. "Hier in dem Club ist doch die Szene, wo sie mit dem Typen auf der Toilette..." (Der Typ ist in dem Roman ein Deutscher, es kommen aber auch andere Ausländer ins YY und hoffen, Wei Hui zu treffen, die ausgesprochen gut aussehen soll).
Ich frage mich,
warum eine Schriftstellerin so was macht. Das muss man sich mal vorstellen: Da besuchen Leute aus aller Welt dein Lieblingsclub und gehen nur auf die Toilette, um sich vorzustellen wie... Und die Toilette ist klein, sehr klein sogar, da kann man alleine schon kaum drin stehen. Außerdem klebt an der roten Wand eine italienische Buchbesprechung von "Shanghai Baby" (die chinesische Ausgabe steht auf dem Index, nicht zuletzt wegen der Toilettenszene). "There are so many cool things in this town, man".
Obwohl ich die Szene mindestens genauso anstößig finde wie die Zensoren der Volksrepublik China, wird mir immer wohl zu Mute, wenn ich das "Shanghai Baby"-Déjà-vu habe. Ich fühle mich durch die gemeinsame Lektüre mit den anderen geistig verbunden, weniger verloren in dieser riesigen Stadt, die sich ständig verändert. Dann gibt's aber noch ein anderes Déjà-vu und das ist bitter.
Am gleichen Abend, die Parallelstraße Fuxing Richtung Westen hinunter bis zum Cotton Club. Eine Jazzband aus New York spielt, internationales Publikum, an der Bar Hartmut aus dem Rheinland (schon wieder ein Rheinländer). "Ja Mensch, aus Deutschland kommst Du, da können wir ja deutsch reden!" Seit acht Jahren lebt Hartmut schon in Asien, und diese Idioten und Kommunisten gehen ihm langsam auf den Zeiger. Er zupft der Kellnerin in Brusthöhe am Qipao: "Nicht mal eine Schraube gerade reinschlagen können die". Hartmut arbeitet als Ingenieur für eine chinesische Firma.
Die Band intoniert
gerade eine ausgesprochen bluesige Version von "Summertime", da hält Hartmut dagegen mit "Auf der Heide blüht ein kleines Blüh-hü-melein". Hartmut hat einen mächtigen Bass. Und Hartmut trinkt viel. Der Tresen ist in der Mitte leicht abgestuft. Hartmut stellt sein Bier immer genau auf diese kleine Stufe. Es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis das Glas einmal umkippt. Mit jedem Schluck, den Hartmut nimmt, spüre ich das Déjà-vu nahen. Und es kommt: Er liebe sein Vaterland, sagt Hartmut, er sei "stolz, ein Deutscher zu sein." Hartmut ist auch verheiratet, mit einer Malayin, und bald wird er Papa, ein "guter deutscher Vater". Ich gratuliere ihm und frage, ob seine Frau auch eine gute deutsche Mutter würde. Das bejaht Hartmut.
Dann steht er auf und ruft: "Sieg Heil! Sieg Heil!" Dabei verschüttet er ein wenig Bier, das die Bedienung diskret vom Tresen wischt. Ich fordere Hartmut auf, sich wieder zu setzen. Hartmut setzt sich und drückt mir viele Male die Hand, ich weiß nicht warum. "Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein," sagt er wieder, nimmt einen mächtigen Schluck und stellt sein Glas auf die Stufe. Das Bier schwappt rechts und links am Glasrand hoch und erzeugt ein nervöses Ruckeln. Das Bier beruhigt sich wieder. Aber Hartmut kippt vom Stuhl.