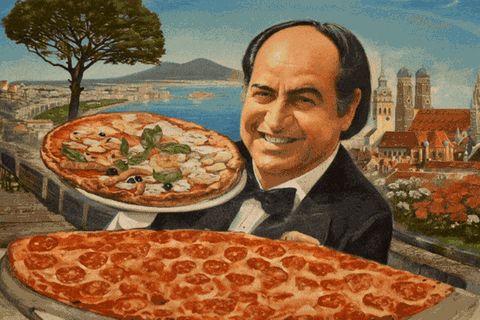Die Villa Vigoni am Comer See ist eine der schönsten deutschen Kulturinstitute Europas. Zwei herrschaftliche Villen, Bauernhäuser, Ländereien und eine Kunstsammlung zählen zu dem Besitz, den der letzte kinderlose Nachkomme einer wohlhabenden deutsch-italienischen Familie, Don Ignazio Vigoni Medici di Marignano, der Bundesrepublik vermacht hatte. Doch nun könnte das idyllische Anwesen nach einem Urteil des obersten Zivilgerichts in Rom unter den Hammer kommen, wenn Deutschland sich weigert, Entschädigungen für Opfer von Nazi-Massakern zu bezahlen.
Es geht um 60 Millionen Euro Schadensersatz für die Überlebenden aus dem griechischen Dorf Distomo, wo 1944 SS-Schergen 218 Menschen töteten. Was hat das Dorf mit der Villa Vigoni zu tun? Die Anwälte der Opfer fordern seit Jahren eine Entschädigung von der Bundesrepublik und hatten bereits vor einem griechischen Gericht Recht bekommen. Nach einem Bericht des "Corriere della Sera" wäre es beinahe zur Pfändung des Goethe-Instituts in Athen gekommen, doch das griechische Justizministerium stoppte in letzter Minute die Vollstreckung. Daraufhin haben die Anwälte versucht, das Urteil in Italien zu vollstrecken, was nach europäischem Recht innerhalb der EU möglich ist. Sie hatten Erfolg: Das Berufungsgericht in Florenz ließ eine Hypothek über 25.000 Euro auf die Villa Vigoni eintragen und der Kassationshof hat das Urteil nun in letzter Instanz bestätigt.
Über 100.000 Italiener könnten klagen
Zeitgleich haben die obersten Zivilrichter in weiteren Urteilen die Ansprüche auf Entschädigung von Italienern anerkannt, die während des Krieges als Zwangsarbeiter nach Deutschland deportiert worden waren. "Deutschland soll Hitlers Sklaven entschädigen", titelte die "Repubblica" in Anspielung auf das Urteil. Den Musterprozess führte eine Gruppe von rund fünfzig Ex-Deportierten aus der Hochburg des Widerstands Val di Susa in Piemont. Doch nach dem Urteil drohen der Bundesrepublik Klagen von mehr als 100.000 ehemaligen italienischen Zwangsarbeitern, die im Alter von 15 bis 17 Jahren aus der Toskana, aus Sizilien, aus Apulien und Venetien deportierten worden waren. Um den Geldforderungen zu entsprechen, könnten nach italienischen Medienberichten Goetheinstitute und Bankkonten des deutschen Staates in Italien gepfändet werden.
Gegen solche Schadensersatz-Forderungen hatte die Bundesrepublik sich bislang mit dem Hinweis auf "Staatenimmunität" verwehrt. Danach können Staaten im Prinzip nicht von Bürgern anderer Staaten belangt werden. Doch die Richter in Rom weisen nun den Einwand Deutschlands ausdrücklich zurück, weil die Immunität bei schweren Verletzungen des Völkerrechts wie Kriegsverbrechen nicht gelte. Die Regierung in Berlin hat sich zu dem Urteil bislang nicht geäußert. Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" sei jedoch zu erwarten, dass Deutschland Italien vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verklagen wird. Das Entschädigungs-Urteil aus Rom hat das deutsch-italienische Verhältnis empfindlich abgekühlt.