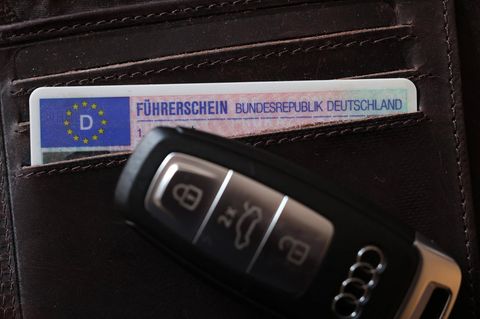Drei Schritte vor, zwei Schritte zurück. Mit der europäischen Einigung ist es wie mit der Echternacher Springprozession. Wer mit dieser mühsamen Form des Fortschritts nicht vertraut ist, der braucht kein Populist zu sein, um genügend Argumente für die These zu finden, dass sich die Europäische Union und damit unser Kontinent heute in einer "Krise" befinden. In das allgemeine Bewusstsein rückte die Erkenntnis von dieser europäischen Malaise durch die ablehnenden Voten in den Referenden in Frankreich und den Niederlanden zum Verfassungsvertrag. So mancher Politiker, Medienvertreter und mit der Europapolitik befasster Wissenschaftler unterstreicht seither den Krisencharakter einer stagnierenden oder gar erodierenden EU. Die meisten berücksichtigen dabei zu wenig, dass Europa immer nur so stark sein kann wie seine im Ministerrat entscheidenden Mitgliedstaaten vital und reformfähig sind!
Den führenden Politikern fehlt es an Mut
Die Globalisierung und die EU-Osterweiterung haben mitunter negative Auswirkungen gezeigt. In diesem Klima der Verunsicherung fehlt den führenden Politikern in den EU-Mitgliedstaaten wenn nicht die notwendige Erkenntnis dann doch oft der politische Mut, um die Schutzfunktion der EU vor überbordenden Prozessen der Globalisierung und ihrer Rolle als friedensstiftender Stabilitätsanker unseres Kontinents zu vermitteln.
Als Antwort auf die großen Herausforderungen unserer Zeit gibt es nun einmal zur Union keine Erfolg versprechende Alternative! Dennoch gibt es in den EU- Mitgliedstaaten immer wieder Kräfte, die in nach Innen gerichteter Nabelschau über eine einseitige Betonung der nationalen Souveränität suggerieren, die Lösungen der großen Probleme unserer Zeit lägen nicht in solidarischer europäischer Politik, sondern in einer rückwärtsgewandten Durchsetzung rein nationaler Interessen zu Lasten des Gemeinschaftsinteresses der Union.
Zur Person
Der Ex-Diplomat Dietrich von Kyaw, 72, war von 1993 bis 1999 Ständiger Vertreter Deutschlands bei der EU. Der promovierte Jurist ist Mitglied der Initiative "Bürger für Europa"
Warnung vor provinziellem Nationalismus
Als Paradebeispiel für diese negative Entwicklung galt bislang immer Großbritannien mit seiner "Half-In-Half-Out"-Attitüde des Rosinenpickens. Inzwischen geben die Gebrüder Kaczynski, als Präsident und Ministerpräsident im Namen Polens handelnd, ein innenpolitisch gewolltes spektakuläres Exempel für einen geradezu provinziellen Nationalismus ab. Hinsichtlich einer Re-Nationalisierung befinden sie sich dabei jedoch durchaus in "guter" Gesellschaft. So verstößt Frankreich mit seinem offiziell als Rückbesinnung auf die Nation etikettierten "Wirtschaftspatriotismus" über die Förderung "nationaler Champions" in schon fast zynischer Weise gegen die Regeln des Binnenmarktes und dessen Grundsatz der Freiheit des Kapitalverkehrs.
Einerseits erhalten französische Unternehmen bei Fusionen einschließlich der Übernahme von Konkurrenten in den übrigen Mitgliedstaaten die volle Unterstützung des französischen Staates. Umgekehrt wehrt Frankreich sich aus "strategischen Gründen" mit aller Kraft gegen Übernahmen französischer Unternehmen. Entsprechend ist neben Italien auch Spanien darauf verfallen, gegen den Widerspruch der EU-Kommission dem französischen Beispiel des Rückfalls in einen Merkantilismus à la Colbert zu folgen und der geplanten Übernahme des Energieunternehmens Endesa durch den deutschen Eon-Konzern größte Hindernisse in den Weg zu legen.
Auch Deutschland gerät in die nationale Versuchung
Angesichts solcher Partner ist es wenig verwunderlich, wenn selbst Deutschland in die Versuchung nationaler Alleingänge gerät. Dabei braucht man sich nicht nur an die verbale Glorifizierung einer endlich und angeblich erst durch ihn erfolgten Durchsetzung nationaler deutscher Interessen in Brüssel durch Ex-Bundeskanzler Schröder zu erinnern.
Deutschland kann sich als vom freien Außenwirtschaftsverkehr abhängiges Land Protektionismus zwar nicht leisten. Aber das VW-Gesetz etwa ist dennoch übernahmefeindlich angelegt. Bei der Dienstleistungsrichtlinie tat sich Deutschland im Verbund mit Frankreich keineswegs als Vorkämpfer echter Liberalisierung hervor. Und in der Energiepolitik fährt die Bundesregierung in der Frage einer Übertragung von Kompetenzen auf die EU-Kommission eine restriktive Linie.
Die deutsche Energiewirtschaft und mit ihr der Bundeswirtschaftsminister orientieren sich an deutschen Partikularinteressen. Sie wünschen eine freie Hand. Eine gemeinsame Bevorratungspolitik der EU lehnen sie ab. Diese Praxis lässt außer Acht, dass die Vorteile des Binnenmarktes für Deutschland mittelfristig nur über wechselseitige Solidarität gewahrt werden können. Im Energiebereich muss dies gerade auch im Hinblick auf die prekäre Versorgungslage der baltischen Republiken und Polens gelten. Das sollten zumindest Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Frank Walter Steinmeier berücksichtigen!
Berlin darf nicht in die Falle tappen
Deutschland hat als zentrale Mittelmacht von erheblichem wirtschaftlichen Gewicht, die damit zugleich aber auch vom freien Waren- und Kapitalverkehr abhängig ist, ein vitales Interesse an der Stabilität Europas, an einem funktionierenden Binnenmarkt nebst Währung, an zufriedenen Nachbarn und Partnern sowie an effektiven gemeinsamen Antworten auf die großen Herausforderungen, denen wir auf uns allein gestellt nicht mehr gewachsen sind. Deswegen darf Deutschland gerade nicht in die Falle einer Re-Nationalisierung europäischer Politik tappen! Es würde dabei letztlich nur verlieren!
Wider die Re-Nationalisierung!
Das schließt eine nachdrückliche - und innerdeutsch besser koordinierte - Wahrnehmung deutscher Interessen in den EU-Gremien keineswegs aus. Es mag sogar bedeuten, dass man sich "aus erzieherischen Gründen" in Fusionsfällen gelegentlich auch einmal gegenüber Frankreich oder Spanien im Einzelfall als ähnlich hinderlich erweist. Letztlich aber sollte Deutschland im Verbund mit den vielen "kleineren" Mitgliedstaaten grundsätzlich gegen Tendenzen einer Re-Nationalisierung Front beziehen, eigene schlechte Beispiele tunlichst vermeiden und unsere EU-Präsidentschaft während der ersten Hälfte 2007 dazu nutzen, um der Europapolitik im engen Zusammenwirken mit der EU-Kommission neue Dynamik zu vermitteln. Das gilt für den Verfassungsvertrag und für eine gemeinsame Politik der Nachbarschaft zu Russland wie den übrigen osteuropäischen Nichtmitgliedern, aber auch für die weitere Vollendung des europäischen Binnenmarktes und die Entwicklung einer europäischen Energiepolitik, die diesen Namen verdient!