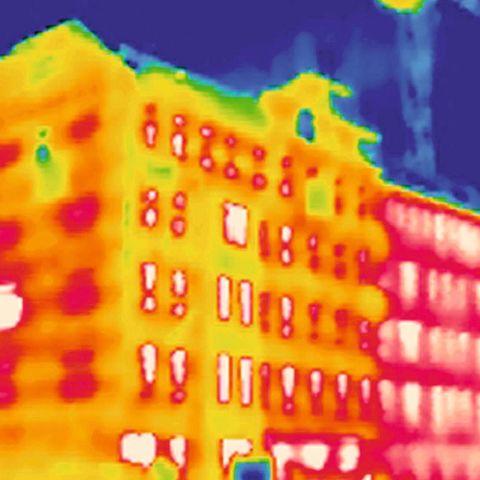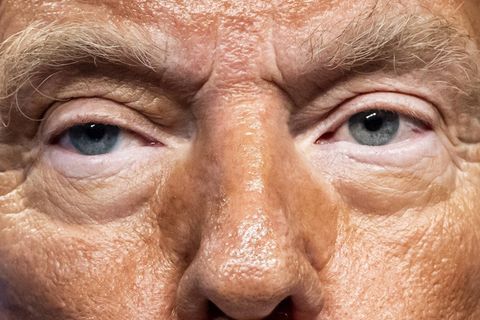Das Bundesverfassungsgericht hat gestern entschieden, dass die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz nachbessern muss, um die Freiheitsrechte jüngerer Generationen zu schützen. Die Karlsruher Richter verpflichteten den Gesetzgeber, bis Ende 2022 die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 genauer zu regeln. Damit waren Verfassungsbeschwerden mehrerer Klimaschützer zum Teil erfolgreich. In der Presse wird das Urteil einhellig begrüßt. Ein Überblick:
"Neue Zürcher Zeitung": "In den unmittelbaren Auswirkungen wirkt der Entscheid des Bundesverfassungsgerichts beinahe läppisch: Der Gesetzgeber wird dazu verpflichtet, bereits 2022 – statt wie bisher gesetzlich vorgesehen erst 2025 – detailliert klarzumachen, nach welchem Fahrplan Deutschland den jährlichen Ausstoss von Treibhausgasen nach 2030 weiter reduzieren will. Mit dieser Anordnung kann die (nächste) Bundesregierung gut leben. Doch auf grundsätzlicher Ebene geht der Gerichtsentscheid sehr viel weiter, mit potenziell tiefgreifenden Folgen für Deutschland. (...) Auch wenn die Richter in der Begründung dies immer wieder zu relativieren suchen und auf die Gestaltungsspielräume des Gesetzgebers verweisen, so stellen sie im Kern doch eine absolute, gerichtlich einklagbare grundgesetzliche Pflicht des deutschen Staates fest, als geeignet erachtete Maßnahmen zum Schutz des Weltklimas durchzusetzen."
"Süddeutsche Zeitung": "Das Bundesverfassungsgericht hat eine historische Entscheidung zum Klimaschutz getroffen. Nicht, weil der Kampf gegen den Klimawandel damit schon gewonnen wäre. Sondern weil der fulminante Beschluss auf 127 Seiten den Schutz künftiger Generationen vor den durch Erderwärmung verursachten Stürmen, Fluten und Dürreperioden endlich zu einer verfassungsrechtlich verbindlichen Kategorie macht. Die Verteidigung der Grundrechte gegen die Versäumnisse beim Klimaschutz darf nicht mehr auf übermorgen verschoben werden, auch nicht auf morgen – sie muss heute beginnen. Das ist fortan die Leitlinie des Grundgesetzes. (...) Richtig ist zwar, dass Klimapolitik ein äußerst komplexes und zudem ein internationales Geschäft ist. Dafür sind Gerichte nicht gemacht, das kann nur die Politik leisten."

"Handelsblatt": "Mit halbherziger Klimapolitik kann es nicht weitergehen – das haben die Richter der Politik ins Pflichtenheft geschrieben. Die nächsten Monate müssen davon geprägt sein, die klimafreundlichsten und gleichzeitig wirtschaftlich effizientesten Ideen zu diskutieren, wie der Kampf gegen die Erderwärmung ambitionierter voranzubringen ist. Das langfristige, aber dennoch verbindliche Ziel, Klimaneutralität bis 2050 zu gewährleisten, ist nur mit konkreten Maßnahmen, nicht mit mehr oder weniger vagen Bekundungen zu erreichen. Die Hoffnung, dass in Zukunft schon genügend Technologiesprünge die notwendigen Emissionseinsparungen bringen mögen, reicht nicht aus."
"Kölner Stadt-Anzeiger": "Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz ist in doppeltem Sinn eine richtige Klatsche. Sie tut richtig weh und sie tut richtig Not. Denn das, was Bund und Länder nur nach mühsamem Gezerre 2019 beschlossen haben, reicht nicht aus für die international vereinbarte Eindämmung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad. Die Corona-Krise hat gezeigt: Wenn sich eine Bundesregierung einer Katastrophe wirklich bewusst ist, kann sie radikal handeln. Den Klimawandel hat sie bisher nicht als ein solches Drama begriffen. Die junge Klimaschutzbewegung hingegen schon."
"Stuttgarter Zeitung": "Der Beschluss aus Karlsruhe ist ein gravierender, nicht mehr zu heilender Makel für die Abschlussbilanz der zeitweiligen Klimakanzlerin Angela Merkel. Sie scheidet nun mit dem höchstrichterlichen Befund aus dem Amt, die langfristigen Folgen eigener Untätigkeit nicht angemessen bedacht zu haben. Die Antworten der Regierung Merkel auf die bedeutendste aller Zukunftsfragen ist schlichtweg ungenügend. Allen Ankündigungen zum Trotz wird ist das wohl kaum noch kurzfristig zu reparieren sein. Merkels potenzielle Erbin an der Macht, die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, darf sich tatsächlich ermutigt fühlen. Ihre Partei bekommt Rückenwind aus Karlsruhe."
"Augsburger Allgemeine": "Die Richter in den ergrünten Roben erheben den Klimaschutz nun faktisch zum Verfassungsrang. Das wird gewaltige Folgen und Konflikte für Politik und Wirtschaft mit sich bringen. (…) Wie in vielen Bereichen bestimmen die Verfassungsrichter nun auch beim Umweltschutz die Politik maßgeblich mit, denn die Regierungsmehrheit hat ihre Entscheidungsmöglichkeiten vernachlässigt. Das erscheint problematisch, weil sich getrennte Zuständigkeiten von Regierung, Parlament und Justiz zu einem Verantwortungsgebräu vermischen."
"Weser-Kurier": "Karlsruhe fordert einen vorbeugenden Klimaschutz ein. Soll heißen: Es reicht nicht, einigermaßen konkrete Ziele für die nahe Zukunft vorzugeben, sie aber auf lange Sicht betont vage zu halten. Vielmehr habe die Politik die Pflicht, langfristig zu denken, um spätere Generationen nicht über Gebühr mit den Folgen des Klimawandels zu belasten. Denn die laxen Maßnahmen von heute könnten später brachiale Vorgaben nötig machen und dadurch die Grundrechte einschränken. Damit hat das Bundesverfassungsgericht eine neue Form der Generationengerechtigkeit definiert."
"Badische Zeitung": "Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz ist ein juristischer und politischer Paukenschlag. (...) Sollte irgendjemand im politischen Raum gehofft haben, dass man das Thema vor der Bundestagswahl klein halten oder sich mit halbgaren Aussagen aus der Affäre ziehen könnte, so dürfte diese Hoffnung nun zerstoben sein."
"Volksstimme" (Magdeburg): "Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts überfordert die Politik. Es ist bereits ambitioniert, Klimaziele bis 2030 zu formulieren, die genau abwägen zwischen Freiheitsrechten, ökonomischen und sozialen Folgen. Schwer vorstellbar ist es, bis ins Jahr 2050 genaue Etappenziele bei der Reduzierung von CO2 realistisch zu benennen. Technische Innovationen oder eine beschleunigte Deindustrialisierung kann man nicht vorhersagen. Auch keine Pandemien. Laut des "Expertenrats für Klimafragen" haben wir es nur Corona zu verdanken, dass die Ziele 2020 erreicht wurden. Entweder die Ziele waren also schon jetzt unrealistisch, oder die Mittel, sie zu erreichen. Merkwürdig ist auch, dass das Gericht künftigen Generationen das Recht auf ein mildes Klima zugesteht, aber weder Atommüll, fehlende Generationengerechtigkeit bei der Rente noch die Schuldenlast unserer Nachkommen ein juristisches Problem darstellen."