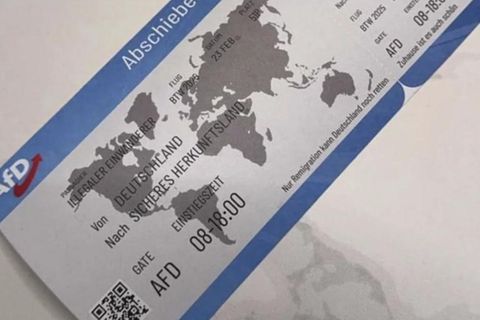Schwerin, das war klar, würde den Rechten nicht reichen. Die rechtsextreme NPD will mehr. Sie will in ganz Deutschland präsent sein: Das nächste strategische Ziel sei es deshalb, nach dem Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern auch in westdeutsche Landesparlamente einzuziehen, sagte Parteichef Udo Voigt am Donnerstag in Berlin-Köpenick . Man wolle nun "den Westen in Angriff nehmen." Es gehe darum, 2008 in die Landtage in Bayern und Hessen gewählt zu werden und 2009 in den Bundestag zu gelangen. Der Fraktionsvorsitzende im Sächsischen Landtag, Holger Apfel, sagte, die NPD wolle "keine mitteldeutsche Regionalpartei sein wie die PDS".
Beratungsstellen für Hartz-IV-Empfänger
Künftig wollen die Rechten darauf setzen, Wähler weniger durch Ideologie als vielmehr durch konkrete Hilfsangebote für sich zu gewinnen. Voigt, der bei der Wahl in Berlin einen Sitz in der Bezirksverordnetenversammlung von Treptow-Köpenick gewonnen hat, kündigte die Einrichtung von "sozialen Beratungsstellen" in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern an. Dort sollten unter anderem Hartz-IV-Empfänger beraten werden.
Was nützt ein Verbotsverfahren?
Die Gegner der Rechtsextremen diskutieren indes weiter, wie der NPD am besten beizukommen ist - politisch oder auf juristischem Wege über ein Verbotsverfahren. Der Staatsrechtler Hans-Peter Schneider sagte, ein Verbot sei bei gründlicher Vorbereitung möglich. Der ehemalige Verfassungsrichter Ernst Benda hielt dagegen, die Erfolgschancen eines solchen Verfahrens seien außerordentlich gering. Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers riet von einem zweiten Verbotsantrag ab. "Wir alle müssen uns eher auf die politische Bekämpfung der NPD konzentrieren", sagte er der Tageszeitung "Die Welt". Weil sich rechte Gruppen bislang innerhalb einer Legislaturperiode fast immer als unfähig zu konstruktiver politischer Arbeit erwiesen, hätten viele Wähler sich wieder demokratischen Parteien zugewendet. Längerfristig dürften rechtsextreme Parteien somit keinen Erfolg haben, sagte Rüttgers.
Ex-Justizministerin kritisiert angebliche "Sprechblasenpolitik"
Die FDP-Politikerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger gab den demokratischen Parteien eine Mitschuld am Erstarken der NPD. Dass die Bevölkerung mehr und mehr auf Distanz gehe, liege an der Sprechblasenpolitik der vergangenen Jahre, sagte die stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion der Chemnitzer "Freien Presse". Zugleich warnte sie davor, die Ursachen des Rechtsextremismus nur in der hohen Arbeitslosigkeit zu suchen. Die Parteien des Bundestages müssten selbstkritisch eingestehen, dass Anspruch und Wirklichkeit der Politik längst nicht mehr übereinstimmten, betonte Leutheusser-Schnarrenberger. Gerade mit der Regierungsübernahme der großen Koalition sei deutlich geworden, "dass sich die Politik vor allem um sich selbst dreht". Der Bürger spüre, dass er kaum noch eine Rolle spiele. Wenn sich diese Haltung nicht ändere, könne sich der Stimmenanteil für die Rechtsextremen bei der nächsten Wahl verdoppeln.