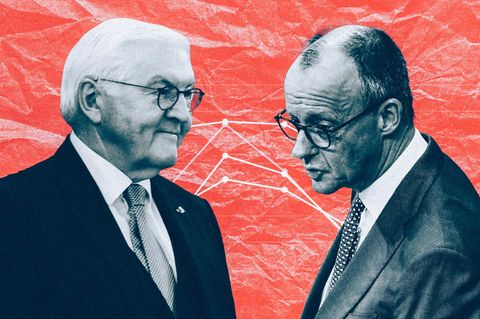Als "Glücksfall" für Deutschland gerühmt, als "idealer Bundespräsident" verehrt, als wortgewaltiger Mahner respektiert: Nur wenige Persönlichkeiten genießen über die Parteigrenzen hinweg solch hohes Ansehen wie Richard von Weizsäcker. Der einstige Bundespräsident feiert nun seinen 90. Geburtstag - und immer noch mischt er sich mit ebenso unbequemen wie feinsinnigen Anmerkungen in aktuelle Debatten ein.
Für seine Partei, die CDU, war und ist Weizsäcker alles andere als ein braver Gefolgsmann. So ärgerte er Union und FDP zuletzt kurz vor der Bundestagswahl im vergangenen September mit dem Einwurf, er sehe angesichts der Wirtschaftskrise keinen Spielraum für die versprochenen Steuersenkungen. Widerspruch und Kritik hatte sich Weizsäcker aber auch schon während seiner Zeit als aktiver Politiker und als Präsident eingehandelt. Im Gedächtnis haften blieb etwa seine Parteienschelte, mit der er sich 1992 als Präsident an alle politischen Lager richtete. "Machtversessenheit" hielt er damals der "Politikerschicht" vor.
Der am 15. April 1920 geborene Weizsäcker zählt zu der Generation, die durch die NS-Zeit, den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen geprägt wurde. Und so ist auch seine wichtigste Rede mit dieser deutschen Katastrophe verknüpft: 1985 hielt er 40 Jahre nach Kriegsende im Bundestag die Ansprache, mit der er sich in die Geschichtsbücher einschrieb. "Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung", rief er auch den Deutschen zu, die damit Niederlage und Kapitulation verbanden. "Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen", sagte er mit Blick auf die Auswirkungen der Nazi-Herrschaft.
Dabei hat der in Stuttgart geborene Diplomatensohn Weizsäcker selbst eine sehr schmerzliche Verbindung zur NS-Zeit. 1938 zum Reichsarbeitsdienst eingezogen, nahm er später als Soldat an den Feldzügen gegen Polen und die Sowjetunion teil, wobei er mehrfach verwundet wurde. Nach Kriegsende studierte Weizsäcker Rechtswissenschaften und Geschichte und half bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen bei der Verteidigung seines Vaters, der zu mehrjähriger Haft verurteilt wurde.
Der "liberale Großbürger" Weizsäcker, wie ihn einer seiner engsten Mitarbeiter unlängst charakterisierte, trat 1954 in die CDU ein. Nach Stationen bei Mannesmann, bei einem Bankhaus und der Chemiefirma Boehringer übernahm er 1964 das Präsidentenamt des evangelischen Kirchentages. Auf Vorschlag von Helmut Kohl, der sich Jahre später allerdings von Weizsäcker distanzierte, kam er 1966 in den CDU-Bundesvorstand. In den Bundestag zog Weizsäcker 1969 ein, wo er zum stellvertretenden Unionsfraktionschef aufstieg. Zu dem Zeitpunkt war er schon Vater von vier Kindern, 1953 hatte er Marianne von Kretschmann geheiratet.
Die Tragik der deutschen Teilung erlebte Weizsäcker nicht zuletzt als Regierender Bürgermeister von Berlin in den Jahren von 1981 bis 1984 hautnah. Und so setzte er sich auch als Bundespräsident ab 1984 für die Aussöhnung mit dem Ostblock und Gespräche mit der DDR ein, wenngleich er in seiner zweiten Amtszeit für eine behutsame Wiedervereinigung warb: "Sich zu vereinen, heißt teilen lernen", mahnte er 1990. Seine letzte Rede als Staatsoberhaupt nutzte er 1994, um Ausländerhass und Rechtsextremismus anzuprangern.
Die "moralische Instanz" Weizsäcker zog sich auch danach nicht aufs Altenteil zurück: In Arbeitsgruppen und diversen Gremien blieb er aktiv. Die Liste der Auszeichnungen und Ehrungen für den Alt-Präsidenten ist denn auch schier endlos - sie reicht vom Bundesverdienstkreuz über den Leo-Baeck-Preis bis zur Ehrendoktorwürde der Prager Karls-Universität. Weitere Würdigungen und Feierlichkeiten erwarten den Jubilar nun zu seinem 90. Geburtstag. So hat Bundespräsident Horst Köhler am 22. April zu einem Abendessen zu Ehren von Weizsäcker ins Schloss Bellevue geladen. Sein Rezept für geistige und körperliche Fitness hatte Weizsäcker angeblich schon bei seinem 80. Geburtstag verraten: "Manche machen ihre Marathonläufe im Wald, andere trainieren ihre Läufe im Kopf..."