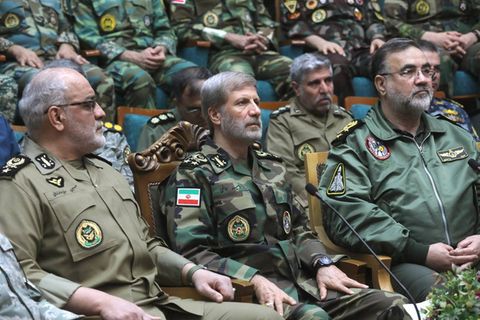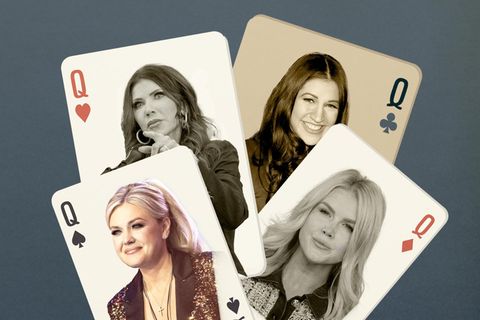Mühsam und ungelenk wankte am Morgen des Pfingstmontags 1828 ein Junge durch die Straßen Nürnbergs. Der Sprache war der verwahrloste Sonderling kaum mächtig, einzig mit Hilfe von Feder und Papier konnte er seinen Namen kundtun: "Kaspar Hauser". Wer er war, ist bis heute ein Rätsel geblieben. Der Mythos um Kaspar Hauser lebt von der ungeklärten Frage: Woher kam der Junge damals am 26. Mai vor 175 Jahren, als er plötzlich mitten in der fränkischen Stadt auftauchte?
Kaspar Hauser hatte sicher keine angenehme Kindheit. "Sein ganzes Wesen und Benehmen zeigte an ihm ein kaum zwei- bis dreijähriges Kind in einem Jünglingskörper", befand der Präsident des Appellationsgerichts zu Ansbach, Anselm Ritter von Feuerbach, der zum Gönner Hausers wurde. Dieser ekelte sich anfangs vor Fleisch und Milch, nahm lediglich Brot und Wasser zu sich - etwas anderes war er offensichtlich nicht gewöhnt. Erst unter der Obhut eines Nürnberger Professors gedieh Kaspar. Bald zeigte sich, dass er äußerst intelligent war und begabt im Zeichnen und Musizieren.
"Die Damenwelt lag ihm zu Füßen"
Kaspar Hausers unbeschwerte Jugendzeit endete jäh im Jahr 1829: Ein unbekannter Maskierter verübte ein Attentat auf ihn. Hauser überlebte mit einer schweren Kopfverletzung. Einige Zeit später siedelte Hauser nach Ansbach über und nahm dort eine Stelle als Schreiberling am Gericht an. Er widmete sich weiter der Kunst und war mittlerweile ein rechter Feinschmecker geworden; zudem hatte er sich mit der Tochter des Regierungspräsidenten, Lila von Stichaner, angefreundet. Sehr charmant soll der junge Mann gewesen sein. "Die Damenwelt lag ihm zu Füßen", berichtet der Ansbacher Historiker und Stadtführer Alexander Biernoth.
Zu einer Liebschaft aber kam es nicht mehr. Am 14. Dezember 1833 wurde er im Ansbacher Hofgarten niedergestochen und starb. Der Mörder entkam unerkannt. "Hier ruht Kaspar Hauser, ein Rätsel seiner Zeit, unbekannt die Geburt, geheimnisvoll die Umstände seines Todes", steht auf seinem Grabstein auf dem Ansbacher Stadtfriedhof. Das Rätsel um seine Person faszinierte und beschäftigte schon seine Zeitgenossen. Anselm von Feuerbach etwa sah es als erwiesen an, dass Kaspar Hauser der legitime Nachfolger des badischen Großherzogs war und im Gerangel um die Thronfolge beseitigt worden war. Oder entsprang Hauser vielleicht einem anderen europäischen Adelsgeschlecht? Hatte ihn gar eine Magd aus Tirol geboren?
Kaspar Hauser als Film, Buch und Lied
In der Folgezeit beschäftigte Hauser Kriminologen, Literaten, Pädagogen und Esoteriker gleichermaßen. Kurt Tucholsky wählte seinen Namen zu einem seiner Pseudonyme, in der Medizin hat sich der Begriff des "Kaspar-Hauser-Syndroms" etabliert. Mehr als 2000 Bücher und an die 15 000 Broschüren, Artikel, Gedichte und Lieder sind seit dem Auftauchen des Sonderlings vor 175 Jahren entstanden. Seine Geschichte wurde auch verfilmt.
Eine vom Magazin "Der Spiegel" und der Stadt Ansbach in Auftrag gegebene Analyse kam 1996 zu dem Ergebnis, dass Hauser kein badischer Prinz gewesen sei. Damals wurde Blut von einer Unterhose Hausers analysiert. Das Institut für Rechtsmedizin der Universität Münster analysierte im vergangenen Jahr Haaren und Körperzellen Kaspar Hausers und zog einen anderen Schluss: "Es ist weiterhin offen, ob der Junge mit dem Hause Baden verwandt war", sagt Institutsleiter Bernd Brinkmann. Brinkmann will weiter forschen und rechnet mit neuen Erkenntnissen in etwa einem Vierteljahr.
Der Mythos darf weiter wuchern
Eine letztendliche Aufklärung steht also aus, der Mythos darf weiter wuchern. Heute noch legen Grabpilger Liebesbriefe und Pralinen zwischen die Papageientulpen auf Hausers letzter Ruhestätte. Konditoren preisen eine Kaspar-Hauser-Torte an. Alle zwei Jahre werden in Ansbach Kaspar-Hauser-Festspiele inszeniert. Die Frage nach der Herkunft des anfangs sprachlosen Sonderlings, der wie aus dem Nichts in Nürnberg stand, gerät bei all dem Spektakel nahezu ins Hintertreffen. Der Stadt Ansbach ist das nicht unlieb, wie Biernoth erläutert: "Je unaufgeklärter der Fall, desto besser für die Stadt."