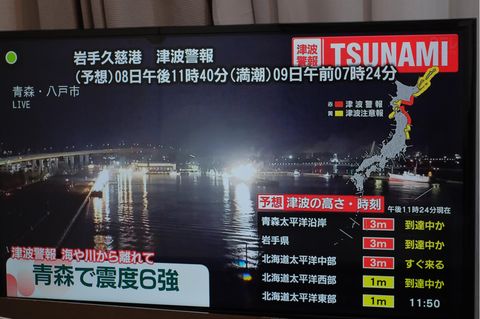Mit ihrer energiepolitischen Kehrtwende hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Preise im Stromhandel auf ein Zweijahreshoch getrieben. Kontrakte für Stromlieferungen in einem Jahr, die als Referenz für ganz Europa gelten, notierten am Mittwoch an der Leipziger Energiebörse EEX bei 58,75 Euro pro Megawattstunde. Vergleichbare Preise wurden zuletzt Anfang 2009 errreicht. Gleichzeitig treibt die Atomkatastrophe in Japan auch die Weltmarktpreise für Gas und Kohle in die Höhe. Lesen Sie nachfolgend, wie sich die gegenwärtige Krise auf die Verbraucher auswirkt.
Was bedeutet der höhere Börsenkurs für die Strompreise?
An der Strombörse EEX in Leipzig handeln Energieversorger und Industriekunden die Großhandelspreise für Strom aus. Sie richten sich unter anderem nach den Kosten für die Erzeugung sowie nach Angebot und Nachfrage. Wegen der befürchteten Verknappung des in Deutschland erzeugten Stroms durch die Abschaltung der sieben Kraftwerke zogen die Preise schon am Dienstag kräftig an.
Die Kosten für Beschaffung und Vertrieb von Strom durch die Versorger machen laut Daten der Bundesnetzagentur aber nur 35 Prozent der Endkundenpreise aus. Der Rest entfällt auf Netzentgelte, Steuern und weiteren Abgaben, unter anderem die Einspeisevergütung für Erzeuger erneuerbarer Energien (EEG-Umlage).
Wie sich eine endgültige Abschaltung der sieben Atomkraftwerke auf den Strompreis auswirken würde, hängt davon ab, durch welche Energiequellen sie ersetzt werden. Bislang plant die Bundesregierung, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis 2020 auf mindestens 35 Prozent zu steigern. Laut einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) wäre nach diesem Zeitplan für 2020 ein Großhandelspreis von 49,30 Euro pro Megawattstunde zu erwarten, das wäre eine Steigerung um elf Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Börsenpreis 2010.
Was kostet der Ausbau erneuerbarer Energien?
Ein beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien würde zwar die EEG-Umlage in die Höhe treiben, gleichzeitig aber helfen, die Ausgaben für fossile Brennstoffe zu begrenzen. Nach Berechnungen des DIW sind die steigenden Weltmarktpreise für Öl und Kohle für den Strompreis relevanter als die Einspeisevergütung. Würde auf einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien ganz verzichtet, wäre wegen der steigenden Rohstoffpreise laut DIW in zehn Jahren ein Börsenpreis von 52,50 Euro pro Megawattstunde zu erwarten.
Wie sich die Preise entwickeln werden, hängt also vom künftigen Strommix ab. 2010 wurden 17 Prozent der in Deutschland erzeugten Strommenge aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen, die Kernenergie steuerte 23 Prozent bei. Braun- und Steinkohlekraftwerke erzeugten zusammen 41 Prozent, Gaskraftwerke 14 und Heizöl sowie Pumpspeicher fünf Prozent des Stroms. Die DIW-Expertin Claudia Kemfert äußerte am Dienstag die Befürchtung, dass bei einer Stilllegung der sieben AKW "im großen Stile Kohlekraftwerke" gebaut würden. "Mit zusätzlichen Kohlekraftwerken wären aber die Klimaschutzziele nicht mehr zu erreichen", sagte Kemfert FTD.de.
Welche Folgen hat die Atomkrise für den Ölpreis?
Nach einem Einbruch um gut vier Prozent am Dienstag haben sich die Preise für den Treibstoff der Weltwirtschaft am Mittwoch wieder leicht erholt. Terminkontrakte zur Lieferung der Nordseesorte Brent im April notierten wieder über der Marke von 110 Dollar pro Barrel (159 Liter), nachdem sie am Dienstag zeitweise auf 107,35 Dollar gefallen waren. Nach dem Erdbeben in Japan, der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, hatten zahlreiche Anleger in Erwartung einer sinkenden Nachfrage ihre Öl-Kontrakte abgestoßen.
Dass die Preise am Mittwoch wieder anzogen, lag an der Eskalation der politischen Unruhen in Bahrain. Der Inselstaat zählt mit einer Fördermenge von rund 0,2 Millionen Barrel täglich zwar nicht zu den großen Produzenten, in den Konflikt ist aber auch der größte Öl-Exporteur Saudi-Arabien verwickelt. Das Nachbarland hatte am Montag 1000 Soldaten nach Bahrain geschickt, um der bedrängten Herrscherfamilie beizustehen.
Unabhängig von der brenzligen Lage im Nahen Osten halten viele Analysten den Einbruch der Ölpreise nach der Katastrophe in Japan für übertrieben. Zwar dürften die Zerstörungen durch das Erdbeben und den Tsunami das Wirtschaftswachstum zunächst dämpfen. Gleichzeitig wird Japan nach der Stilllegung mehrerer Kernkraftwerke aber verstärkt auf fossile Brennstoffe zurückgreifen müssen.
Wie viel Energie braucht Japan?
"Zunächst könnte die Nachfrage zurückgehen, wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet bleiben, könnte sie aber wieder kräftig anziehen", sagte am Dienstag David Fyfe von der Internationalen Energieagentur (IEA). Besonders rasch dürfte nach Einschätzung des Researchhauses JBC Energy der Bedarf an Diesel für Notstromgeneratoren steigen. "Wir sehen Potenzial für einen Anstieg des Verbrauchs um 0,5 Millionen Barrel pro Tag bei allen Ölprodukten."
Seit dem Beben am Freitag mussten elf japanische Atomreaktoren mit einer Leistung von rund 9700 Megawatt vom Netz genommen werden. Drei weitere waren schon vor der Katastrophe für Wartungsarbeiten stillgelegt worden. Damit sind insgesamt 14 Reaktoren außer Betrieb, die normalerweise rund 12.400 Megawatt Strom produzieren. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters sind zudem konventionelle Kraftwerke mit einer Leistung von rund 10.800 Megawatt lahmgelegt.
Wie verhält es sich mit anderen Energieträgern?
Der Preis für Terminkontrakte zur Lieferung von Erdgas im April kletterte am Dienstag in New York um 1,2 Prozent. Der Preis für Ein-Jahres-Kontrakte zur Lieferung von Kohle nach Westeuropa erreichte mit 128,50 Dollar pro Tonne den höchsten Stand seit Oktober 2008.
In der Vergangenheit hatte Japan nach der Schließung von Kernkraftwerken die Einfuhr von Kohle und Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG) verstärkt. Anders als etwa Deutschland kann der Inselstaat Gas nicht über Pipelines einführen. Stattdessen muss der Energieträger in verflüssigter Form mit Tankern nach Japan geschafft werden.
Die französische Bank Société Générale erwartet nach der Katastrophe einen Anstieg der Flüssiggas-Importe um fünf Milliarden Kubikmeter in diesem und um zwei Milliarden Kubikmeter in den kommenden Jahren, falls die beiden am schwersten getroffenen Kraftwerke in Fukushima endgültig stillgelegt werden. Die Schweizer Bank UBS prognostiziert sogar einen Anstieg der LNG-Einfuhren um bis zu 15 Milliarden Kubikmeter.
Was ist mit den Gaspreisen?
DIW-Expertin Kemfert erwartet dennoch keinen nachhaltigen Anstieg der LNG-Preise. "Eine Verknappung beim Flüssiggas sehe ich nicht", sagte sie FTD.de. Zur Begründung verwies sie auf das weltweite Überangebot an Gas durch den Einsatz neuer Bohrtechniken in den USA.
Die vergleichsweise hohen Gaspreise in Deutschland seien "in erster Linie in den langfristigen Lieferverträgen mit Russland begründet, die eine Bindung an den Ölpreis vorsehen. Diese Ölpreisbindung hat überhaupt keinen Sinn mehr, weil der Börsenpreis für Gas viel niedriger ist und Öl schneller knapper und teurer wird."
Auch die Folgen des Bebens für den Kohlepreis dürften sich in Grenzen halten: Nach Einschätzung von Société Générale werden die japanischen Importe in diesem Jahr zwar um acht Millionen Tonnen und dauerhaft um rund drei Millionen Tonnen jährlich zulegen, gemessen am Gesamtmarkt von insgesamt 650 Millionen Tonnen sei diese Menge aber zu vernachlässigen. Sollten allerdings Deutschland und weitere Staaten aus der Atomenergie aussteigen, dürfte aber auch die weltweite Nachfrage steigen.
Zudem erhöht ein Verzicht auf die Kernenergie die Kosten für die Vermeidung von Treibhausgas-Emissionen. Kernkraftwerke stoßen kaum CO2 aus. Würden sie durch Kohle- oder Gaskraftwerke ersetzt, so müssten die Betreiber verstärkt Emissionszertifikate zukaufen, um die Klimaschutzauflagen zu erfüllen. Die Kosten von EU-Emissionszertifikaten stiegen am Mittwoch in London zeitweise auf 17,55 Euro, den höchsten Stand seit Dezember 2008. Höhere Ausgaben für den Klimaschutz könnten von den Energiekonzernen an die Verbraucher weitergereicht werden.