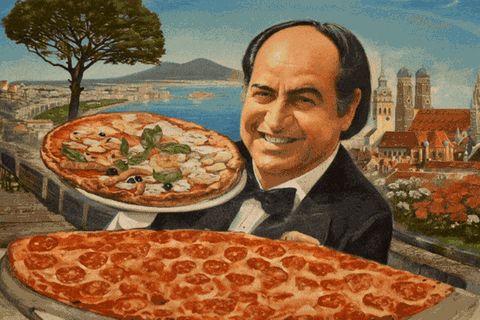Berlusconi weg, Probleme weg? Politik und Märkte hoffen auf diese einfache Kausalität. Sie irren. Italien war immer schon schlecht regiert, bereits lange vor Berlusconi. Daran wird auch der kluge Technokrat Mario Monti nichts ändern können. Denn seit vor genau 150 Jahren der Volksheld Garibaldi und der adelige Diplomat Cavour den italienischen Einheitsstaat schufen, ist südlich der Alpen nicht zusammengewachsen, was nicht zusammengehören will. Im Gegenteil: Die Regierungen in Rom wechselten, der Duce trieb sein Unwesen, der König ging, die Republik kam. Der Nord-Süd-Gegensatz blieb bis in die Gegenwart bestehen.
In Italien stand seit eh einem wohlhabenden Norden ein verarmter Süden gegenüber. Turin, Genua und Mailand, teilweise Bologna, Florenz und Venedig waren schon im Mittelalter wirtschaftlich blühende Metropolen, geprägt von lokaler Kultur, republikanischem Geist, einem florierenden Handelswesen und einem bürgerlichen Unternehmertum. Kleine Familienbetriebe bilden bis heute das Rückgrat einer breit diversifizierten Industrie. Das Pro-Kopf-Einkommen war und ist eines der höchsten in ganz Europa.
Der Norden sieht sich als Zahlmeister
Südlich von Rom begann bereits seit langem das ökonomische Elend. Weil junge Menschen ihr Wohl anderswo suchen, prägen verlassene und zerfallende Dörfer mit einer überalterten Bevölkerung das Bild Kalabriens und Siziliens. "Christus kam (eben tatsächlich) nur bis Eboli", wie es Carlo Levi beklagte. Was in Nordeuropa als künstliches Freilichtmuseum das Leben von früher für kommende Generationen in Erinnerung halten soll, ist in Süditalien noch alltägliche Realität. Die Institutionen sind archaisch. Die Strukturen patriarchalisch. Vetternwirtschaft und Korruption bleiben weit verbreitet. Aus dem einstmals blühenden sizilianischen Königreich ist das rückständige Altenheim Italiens und das Armenhaus Europas geworden.
Das Verhältnis zwischen Nord- und Süditalien war immer gespannt. Der Norden sah sich als Zahlmeister, der Süden als abhängiges Protektorat. Der Norditaliener empfindet den Süditaliener als Belastung, der Süditaliener den Norditaliener als Besatzer. Italien ist ökonomisch, aber auch politisch und kulturell, ein zutiefst gespaltenes Land geblieben trotz aller Anstrengungen mit immens viel Geld – auch aus Brüssel – dieser Trennung entgegenzuwirken. Der Fall Italiens zeigt, wie unterschiedlich selbst scheinbar Gleiches wie der "Italiener" ist. Und wie lange es dauert, und wie viel es kostet, um aus Feinden Freunde und aus Sizilianern oder Lombarden Italiener zu machen, um am Ende doch zu scheitern.
So wollte es die Liga Nord
Mario Monti wird den Zerfall Italiens nicht aufhalten, sondern nur bremsen können. Genauso wenig wie das einem seiner unmittelbaren Vorgänger, Romano Prodi, gelang. Auch Prodi war Wirtschaftsprofessor und eher Technokrat als Politiker, und auch er feierte als Präsident der Europäischen Kommission von September 1999 bis November 2004 – wie Monti – seine größten persönlichen Erfolge in Brüssel und nicht in Rom. Auch Prodi hatte Mitte der 1990er Jahre Silvio Berlusconi aus dem Amt des italienischen Ministerpräsidenten verjagt, hatte das damals schon vor dem Staatsbankrott stehende Land auf Sparkurs gebracht, was letztlich auch Italien den Beitritt zum Euro-Raum ermöglichte, und ist dann bei der Modernisierung Italiens doch gescheitert. Nach der innenpolitischen Kraftanstrengung und dem europapolitischen Megaerfolg des Euro-Beitritts erlahmte die Reformkraft der Technokraten. Berlusconi kehrte zurück und damit der ökonomische Schlendrian. Heute leidet die drittgrößte Volkswirtschaft Europas und die neuntstärkste der Welt unter einer Wachstumsschwäche als Folge schwerer Strukturprobleme und einer hohen Unterbeschäftigung.
Das Ende Berlusconis ist nicht einfach das Ende einer weiteren erfolglosen Nachkriegsregierung Italiens. Es ist der Anfang vom Ende der italienischen Einheit. Genauso wie es die Liga Nord wollte und unverändert will, weshalb sie alle wirklichen Schritte zu einer italienischen Einigung verhinderte und nun auch der Notlösung Monti nur eine kurze Regierungszeit einräumt. Sie kannte und kennt nur ein politisches Ziel: Sie will Süditalien loswerden. Dieser Absicht ist sie mit dem Sturz Berlusconis ein Stück näher gekommen. Denn die nun folgenden harten Strukturanpassungen auf dem Arbeitsmarkt, die Sparanstrengungen bei öffentlichen Haushalten und im Sozialwesen sowie der Abbau einer überbordenden Staatsbürokratie werden gewaltige Verteilungskämpfe innerhalb der italienischen Gesellschaft provozieren. Die Nord-Süd-Diskrepanz wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Der Norditaliener wird genauso wenig verstehen, wieso er für den Süden bluten soll, wie das in Deutschland der Fall ist, wenn es um finanzielle Hilfen für Griechenland geht.
Vereinigte Regionen von Europa
Ein Zerfall Italiens wird die Europäische Union vor gewaltige Herausforderungen stellen. Denn er wird dazu führen, dass die Modernisierung und Finanzierung Süditaliens weniger denn je eine Aufgabe Norditaliens, sondern immer mehr zu einer weiteren Aufgabe Nordeuropas werden wird. Ob die nordeuropäischen Bevölkerungen dazu bereit sind, ist aus heutiger Sicht mehr als fraglich. Deshalb wäre man klug beraten, intensiver über die Vereinigten Regionen von Europa nachzudenken. Sie könnten nicht nur für Italien eine Lösung werden. Sie könnten auch andernorts eine Alternative dafür bieten, dass nicht zusammenwachsen muss, was nicht zusammenwachsen will.