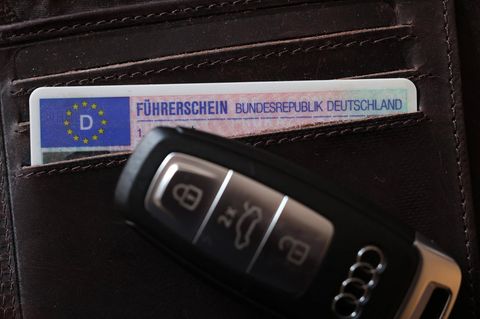Es ist schon ein Kreuz mit den italienischen Namen. Niemand hat ein Problem, "Ferrari" korrekt auszusprechen, aber für viele sind die Sportwagen aus Sant’Agata noch immer "Lambordschienis". Gut möglich, dass die Aufgabe des "h" im Namen doch bald phonetisches Allgemeingut wird, denn immer häufiger greifen gut betuchte Zeitgenossen, die einen standesgemäßen Rennwagen für die Straße suchen, zu Lamborghini.
Bis 1963 war die Sportwagenwelt noch in Ordnung. Alles, was schnell und teuer war, dazu noch aus Italien kam, hieß Ferrari oder Maserati. Es war das Jahr, in dem sich Ferruccio Lamborghini, seines Zeichens erfolgreicher Produzent bärenstarker Traktoren, maßlos über Enzo Ferrari und die seiner Meinung nach dürftige Qualität von dessen Autos ärgerte. Der Legende nach gab Ferruccio Lamborghini seinen leitenden Mitarbeitern den Befehl, einen eigenen Sportwagen auf die Räder zu stellen – stärker, schneller und besser als die roten Renner aus Maranello. Automobile Meilensteine wie das Modell Miura oder der Countach kamen dabei heraus, aber nie wurden mehr als 250 Stück jährlich verkauft.
Magie Miura
Ein Star des Genfer Auto Salons 1966 war der Lamborghini Miura. Sein quer eingebauter Zwölfzylinder-Mittelmotor galt als technische Sensation. Gut erhaltene Exemplare des zeitlos eleganten Coupés gehören heute zu den exklusivsten Oldtimern.
Zum 40-jährigen Jubiläum des Miura stellte Lamborghini im März 2006 in Genf die Studie Miura Concept vor und erntete großen Beifall. Das Modell greift bewusst Designelemente des 66er-Sportwagens wieder auf. Dass der Hersteller von der Studie eine Kleinserie plane, wird bisher heftigst dementiert.
Der Statthalter
Seit Audi 1998 die Herrschaft über die kleine Manufaktur in der Nähe von Bologna übernommen hat, hat sich das gründlich geändert. Zwar ist auch das günstigste Erzeugnis der Marke nicht unter 150.000 Euro zu haben, doch auf der Basis der Stückzahlen von 2001 wird sich die Produktion in diesem Jahr mehr als versechsfachen. Und das, obwohl die Modellvielfalt eher bescheiden zu nennen ist. Zurzeit gibt es zwei Modelle in jeweils einer offenen und einer geschlossenen Karosserievariante. Die beiden aktuellsten davon, der Gallardo Spyder und der Murciélago LP 640 sind für dieses Jahr bereits ausverkauft.
Der Fortschritt bei Lamborghini hat einen Namen: Stephan Winkelmann. Als Audi-Chef Martin Winterkorn nach einem geeigneten Mann für den Chefposten in Stant’Agata fahndete, fand er ihn in dem ehemaligen Fiat-Manager. Der Sohn deutscher Eltern ist in Rom aufgewachsen und mit der deutschen wie der italienischen Mentalität bestens vertraut. Mit seinen eleganten Anzügen, dem meist offenen Hemdkragen und wohlgestylter Unordnung im Haar, braucht er sich für mediterranen Habitus nicht zu verstellen.
Entdeckungen sind möglich
"Wir haben keine Geschichte", sagt er, wenn er nach einem der Unterschiede zum Konkurrenten Ferrari gefragt wird. Aber Power haben sie. Der "Stolz der Marke" (Winkelmann), das gerade vorgestellte Modell Murciélago LP 640 hat 20 PS mehr als der aktuelle Ferrari 599 GTB (siehe Kasten). Natürlich werden die Roten irgendwann kontern und mit Pferdestärken allein ist der Wettbewerb nicht zu gewinnen. Deshalb braucht Lamborghini neue Händler. Genau 88 waren es zur Mitte dieses Jahres weltweit, Ferrari hat mehr als doppelt so viele.
Rund jeder zehnte Lamborghini ging 2005 nach Deutschland. Während in den USA rund 40 Prozent der Gesamtproduktion abgesetzt wurden, machten 109 Gallardos und 57 Murciélagos Deutschland zum zweitwichtigsten Markt – noch vor Italien. Die Italiener entdecken Lamborghini gerade neu. Um mehr als 32 Prozent stieg dort der Absatz im vergangenen Halbjahr und auch Deutschland verzeichnete eine zweistellige Zuwachsrate.
Die neuen Reichen
Anderswo auf der Welt ist ähnliches zu erwarten. Die Volkswirtschaften in China, Russland, Indien gebären schon heute in großer Zahl Autonarren, die in jungen Jahren zu märchenhaften Wohlstand gekommen sind. Sich für Luxus und Genuss zu schämen, ist in diesen Ländern ein eher seltenes Phänomen. Noch können statt dessen mangelnde Infrastruktur und dürftige Straßenverhältnisse die Freude an schnellen Autos mindern – doch auch das wird sich ändern. Deshalb wurden in Russland und Indien dieses Jahr Vertretungen eröffnet.
Mehr Umsatz durch immer neue Modelle – das ist nicht Winkelmann Wachstumskurs. Spekulationen, wonach ein Luxusgeländewagen und eine Sportlimousine in Vorbereitung seien, verweist er in Reich der Fabel. Das Angebot soll durch Derivate gespreizt werden, Porsche etwa macht es gerade mit dem 911er vor. Der Gallardo SE ist so ein Abkömmling, eine "Lightweight"-Ausführung durchaus denkbar. "Wir werden das Modell frisch halten", verspricht Winkelmann. Bisher geht seine Rechnung auf. Im ersten Halbjahr 2006 verzeichnete Automobili Lamborghini S.p.A. bei den ausgelieferten Fahrzeugen einen Zuwachs von 45 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2005. Wer jetzt einen Gallardo Spyder oder Murciélago LP 640 ordert, muss rund ein Jahr auf die Übergabe des Autos warten.
Merchandising für die Armen
Auch mit Qualität sind Punkte zu machen. Da hilft die Konzernmutter Audi. Im Ingolstädter Teileregal dürfen sich die Italiener gern bedienen und Lamborghini profitiert auch noch von den günstigen Einkaufspreisen, die Audi bei seinen Lieferanten durchsetzen konnte. Die Synergien, so Winkelmann, "reichen bis zur einzelnen Schraube".
Der Chef hat noch ein weiteres Feld eröffnet, dass es zu beackern gilt. Marken-Image kann man auch bei denen stärken, die nie in die Verlegenheit kommen werden, für einen Lamborghini ihre Garage räumen zu müssen. "Merchandising" heißt das Zauberwort. Basecaps, Poloshirts und Taschen mit dem Stierlogo werden in großer Zahl in den Markt gedrückt – für die amerikanischen Fans mit einem größeren Bullen und für Europäer etwas dezenter. Wer seine Zuneigung zur Marke lieber beim Dinner mit Freunden am eigenen Pool offenbaren will, für den hält das Sortiment ein Austernmesser nebst Kettenhandschuh bereit.