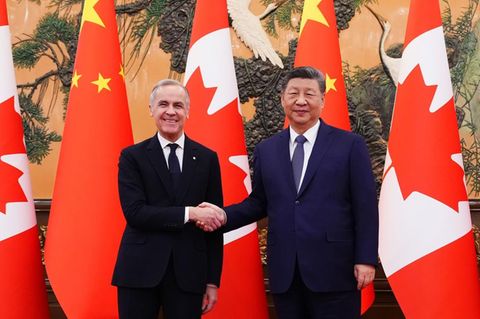Quiankun Wang hat sich gut vorbereitet. Er hat im Internet recherchiert, was die deutsche Bildungsministerin Annette Schavan in den letzten Tagen über China gesagt hat. Sie wünscht sich also ein Treffen von Chinas Staatschefs mit dem Dalai Lama. Das fand der 26-Jährige so interessant, dass er den Link per Mail an seine Kommilitonen weiterschickte. Und so sitzen die Germanistikstudenten nun gut informiert im Hörsaal der Pekinger Universität, wo Schavan einen Vortrag halten soll. Es ist ein ganz besonderer Besuch.
Einige Monate vor den Olympischen Spielen in China hat sich der Streit um Tibet verselbstständigt. Täglich laufen neue Aufreger über den Ticker: Sportler überlegen, der olympischen Eröffnungsfeier fernzubleiben, Politiker streiten über Wirtschaftsboykotte, Manager sorgen sich um die Geschäfte der deutschen Wirtschaft in China. Alles, was an China ohnehin störte, wird in diesen Tagen zur Sprache gebracht, gern auch mit passenden Metaphern: Am Dienstag etwa meldete sich Amnesty International und rügte, dass China mehr Menschen hinrichte als jedes andere Land: "China gewinnt diese makabere Disziplin auch im Jahr vor den Olympischen Spielen."
Ausgerechnet in dieser Zeit reist Annette Schavan durchs Land, als erstes Mitglied der Bundesregierung seit dem Ausbruch der Unruhen - und eng abgestimmt mit Kanzlerin Angela Merkel. Die Reise war lange geplant, Anlass ist das 30-jährige Bestehen eines Abkommens über wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit. Fünf Tage wird der Besuch dauern, es wird in den Gesprächen um den Klimawandel gehen, um Umwelttechnologie, Gesundheitsforschung - und um Menschenrechte. "Unterdrückung ist kein Mittel des Staates, der sich um internationale Kooperation in Wirtschaft und Wissenschaft bemüht", hat Schavan vor ihrem Besuch gesagt und so die Spannung der Öffentlichkeit und natürlich der Pekinger Studenten auf ihren Besuch nochmals angefacht. Wie wird sich Deutschland positionieren? Quiankung Wang ist gespannt.
Schavan spricht von Immanuel Kant und Wilhelm von Humboldt
Es trifft sich gut, dass er im Studium viel über abstrakte deutsche Texte gelernt hat - er bekommt nämlich einen zu hören. Schavan spricht von Immanuel Kant und Wilhelm von Humboldt; spricht vom Prozess der Aufklärung, der nie zu Ende sein kann. Sie erzählt, wie in Europa aus Monarchien Demokratien wurden und dass es kein harmonischer Prozess war. Am Ende sagt sie, wie wichtig grenzüberschreitender Dialog ist. Darüber aber, dass Dialog manchmal verklausuliert sein muss, dass Politiker gerne Diplomatie süß-sauer betreiben, darüber sagt die Ministerin nichts. Es ist schwer offen zu reden, wenn die eigene Nation auf einen schaut, Wähler, Sportverbände, Politikerkollegen, Unternehmer.
China ist wichtig für Deutschland. Im vergangenen Jahr sind die deutschen Exporte nach China um 9,4 Prozent auf 54 Milliarden Euro gestiegen. Mehr als 3000 deutsche Firmen investieren in das aufstrebende Riesenreich. Jeder Satz zählt, gerade in diesen Zeiten. Gerade an einem Tag, an dem Chinesen zu einem Boykott französischer Firmen aufrufen - aus Rache für die Proteste beim olympischen Fackellauf in Paris. Am Ende ist Quiankung Wang enttäuscht. "Ich habe erwartet, dass sie in aller Offenheit mit uns diskutiert, damit wir uns besser verstehen können", sagt er. Vorher über Tibet reden und dann vor Ort nicht, das ärgert ihn. Nicht, dass ihm eine Kritik an der Tibetpolitik seiner Regierung gefallen hätte - aber er hätte gerne persönlich auf sie reagiert. "Ich würde fragen, was sie von den verfälschten Nachrichten über Tibet in den westlichen Medien hält."
Die Wahrnehmung in China ist völlig anders als im Westen
Wang geht auf die beste Hochschule des Landes, hat ein Jahr in Berlin studiert und mag Deutschland. Trotzdem versteht er die Kritik der Deutschen nicht. Die Forderung nach Dialog, die teilt er. Was aber nicht gehe: Wenn Merkel den Dalai Lama trifft; wenn ausländische Politiker die Olympischen Spiele schlecht reden, wenn Demonstranten das Feuer angreifen, wenn man China mangelnden Respekt gegenüber seinen Minderheiten vorwirft.
"Die Wahrnehmung in China ist eine völlig andere als in der westlichen Welt", sagt Paul Mottram von der Kommunikationsberatung Upstream Asia. Chinas staatlich gelenkte Medien vermitteln ein anderes Bild der Unruhen: Hier sind die Aufständischen Terroristen, die unschuldige Han-Chinesen angreifen. Vergleiche mit Al-Kaida tauchen auf, Tonnen von Sprengstoff seien in Tibet konfisziert worden, Selbstmordattentate nur eine Frage der Zeit. Fragen nach den Ursachen der Aufstände, nach dem Wunsch der Tibeter nach mehr Autonomie, sind tabu. Nicht wenige Chinesen halten das Bergvolk für undankbar. Schließlich werde es von der Pekinger Regierung mit viel Geld unterstützt und bei den Steuern bevorzugt.
Der Ärger über die Proteste gegen den Fackellauf ist groß
Und noch etwas ärgert die Chinesen: "Wir wollen hier einfach eine tolle Party zu den Olympischen Spielen. Aber jetzt drohen die Tibeter, uns den Spaß zu verderben", sagt ein chinesischer Manager in Peking. Groß ist der Ärger über die Proteste gegen den Fackellauf. Eine 28-Jährige, die nach einer Krebserkrankung ein Bein verloren hat und im Rollstuhl sitzt, ist zur Volksheldin geworden, weil sie in Paris mit Macht die Fackel verteidigte. Eine Viertelstunde lang sei sie von Demonstranten bedrängt worden, sagt sie. Fotos und Videos davon zirkulieren in chinesischen Internetforen.
Entsprechend angespannt ist die Stimmung beim Besuch von Schavan. Sich für Menschenrechte einsetzen, aber China nicht brüskieren - eine heikle Aufgabe. Denn auch die deutsche Wirtschaft ist alarmiert. "Einschränkungen der geschäftlichen Beziehungen würden die deutsche Wirtschaft empfindlich in einem wichtigen Wachstumsmarkt treffen", sagte BASF-Chef Jürgen Hambrecht diese Woche dem "Handelsblatt". Deutschlands Exporteure fürchten, dass China Aufträge in weniger kritische Länder vergeben könnte.
Rote und weiße Rosen liegen auf dem Tisch
Wie schnell Streit im China entstehen und eskalieren kann, zeigte sich im vergangenen Jahr. Als Angela Merkel den Dalai Lama im Kanzleramt empfing, sagte China reihenweise Termine ab und lud Finanzminister Peer Steinbrück wieder aus. Erst seit Januar, nach vielen Schmusegesprächen des Auswärtigen Amtes, sind die Beziehungen wieder normalisiert. Am Wochenende nun hat die Kanzlerin in einem Interview gesagt, sie würde den Dalai Lama auch in Zukunft mal wieder treffen. Das hat viele Chinesen erneut aufgeregt. Schavan versucht, die Aussage zurechtzurücken. Merkel habe doch nur gesagt: Wenn der Dalai Lama im Mai nach Deutschland kommt, sei sie auf Südamerikareise. "Es wäre doch komisch von ihr, dann noch zu sagen, sie werde ihn nie wieder treffen", sagt die Bildungsministerin.
Schavans erste Begegnung mit Chinas Regierung findet im 18. Stock des Beijing Hotel statt. Von oben blickt man auf den Tiananmen-Platz, den Platz des Himmlischen Friedens, wo 1989 der Volksaufstand niedergeschlagen wurde. Rote und weiße Rosen liegen auf dem Tisch. Als Geschenk für Forschungsminister Gang Wang hat Schavan deutsches Porzellan mitgebracht. Es ist ein dankbarer Auftritt für die Ministerin. Gang Wang hat in Tübingen geforscht, sechs Jahre bei Audi in Ingolstadt gearbeitet. Er mag Deutschland. Als die Beziehungen im vergangenen Jahr schlecht waren, hat er vermittelt. Im Vier-Augen-Gespräch spricht Schavan kurz über Tibet, in größerer Runde ist das kein Thema mehr.
Deutschland will China helfen
Um den Blumenschmuck im 18. Stock herum geht es dann allein um Wissenschaft und Technik. Die alte Kooperation soll neuen Schwung bekommen. Deutschland will China, der aufstrebenden Wissensmacht, bei der Umwelttechnologie helfen. China investiert 20 Millionen Euro in zwei deutsche Teilchenbeschleuniger. Beide Seiten müssen profitieren, so die Linie der Bundesregierung. Den technischen Vorsprung aufgeben, wolle man damit auf keinen Fall.
Unternehmen wie Siemens sorgen sich um diesen Vorsprung. Sicher ist man gern vor Ort, weil die Regierung auf einen Schlag schon mal 60 ICE-Züge bestellt. Aber die Hälfte der Bauteile lässt Siemens in Deutschland fertigen. Man weiß ja nie. Abends beim Empfang in der Botschaft geht es mehr um Geisteswissenschaften als um Technik. Gerade hier, finden die Deutschen, könnten sich die Chinesen durchaus etwas abschauen. "Dialog" und "Transparenz" seien doch Prinzipien der Wissenschaft, die man gut auf die Gesellschaft übertragen könne, sagt der Botschafter Michael Schäfer. Bei allen aktuellen Debatten dürfe man eines nicht vergessen: "Man muss auch die positiven Aspekte sehen." China habe eine Milliarde Menschen aus der Armut geholt. Der Forschungsminister steht im Hintergrund. Er hält ein Glas Sekt in der Hand und lächelt.
Das Verständnis zu China wächst, je näher man dran ist
Es scheint, als wächst das Verständnis zu China, je näher man dran ist. In Deutschland werden die Olympischen Spiele in Peking oft mit denen in Berlin 1936 verglichen. Zwei Diktaturen machen Propaganda, so der Tenor. In China hört man öfter die Parallele zu den Spielen von München 1972. Zwei aufstrebende Staaten sehnen sich nach der Anerkennung der Welt.
Am Abend wird es dann doch einmal angespannt. Schavan hat chinesische Journalisten eingeladen, berichtet von den guten Forschungsbeziehungen der Länder. Ganz zum Schluss meldet sich eine Reporterin. Sie fragt, ob die Bundeskanzlerin nicht die chinesische Geschichte einmal neu lesen wolle - weil sie das bisher alles nicht so richtig verstanden habe, vor allem was Tibet betrifft. Es ist eine der Fragen, bei denen es gut ist, einen Dolmetscher dabei zu haben, das bringt Zeit. "In Deutschland wird die tibetische Geschichte nicht falsch gelesen", sagt Schavan. In Deutschland werde ja nicht über eine Loslösung Tibets diskutiert, sondern über deren kulturellen Identität. Ganz Diplomatin halt, in diesen schwierigen Tagen.