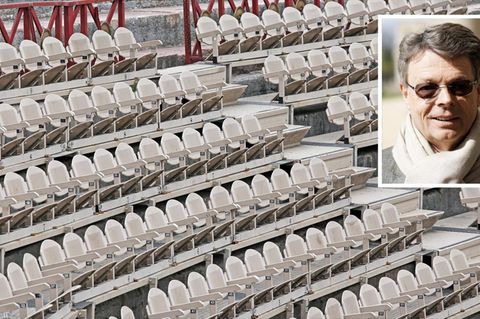Als das Schweinegrippevirus vor einem Jahr von Mexiko aus seinen Zug durch die Welt antrat, wussten selbst Experten nicht, mit welchem Gegner sie es zu tun haben. Nach dem Auftreten der ersten Erkrankungs- und Todesfälle vor allem in Mexiko alarmierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 24. April die Weltgemeinschaft. Zügig breitete sich der Erreger aus und erreichte auch Deutschland. Die ersten Bundesbürger infizierten sich vor allem auf Reisen nach Mexiko, Nordamerika und Spanien. Am 29. April 2009 wurden in Deutschland die ersten drei Schweinegrippefälle bestätigt - bis heute erkrankten hierzulande mehr als 226.000 Menschen, 253 starben. Dennoch hat das Virus lange nicht so stark gewütet, wie anfangs befürchtet.
Mitte November erreichte die Schweinegrippe-Welle in Deutschland ihren ersten Höhepunkt. Die meisten Infektionen verliefen zwar glimpflich. Allerdings erkrankten im Vergleich zur normalen, saisonalen Grippe weniger Ältere, dafür häufig jüngere Menschen. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert-Koch-Institut (RKI) waren 80 Prozent der an Schweinegrippe Erkrankten unter 60 Jahre alt. Möglicherweise sind ältere Menschen durch frühere Influenza-Infektionen besser gegen das neue Virus gewappnet. Die meisten Todesfälle betrafen zwar Menschen mit Vorerkrankungen, aber auch hier waren die 35- bis 59-Jährigen die größte Gruppe.
Diskussionen um die H1N1-Impfung
Für heftige Debatten sorgte die im Herbst gestartete Massenimpfung. Meldungen über verstärkte Nebenwirkungen durch die im Impfstoff Pandemrix enthaltenen Wirkstoffverstärker verunsicherten die Menschen. Dass Bundesbeamte und Soldaten einen anderen Impfstoff ohne Zusätze erhielten, rief zusätzlichen Unmut hervor. Von einer "Zweiklassenmedizin" war die Rede. Nicht zuletzt wegen dieser Debatten, aber auch weil sich der Erreger als weniger gefährlich als angenommen erwies, ließen sich nach Schätzungen des niedersächsischen Gesundheitsministeriums nur rund fünf bis sechs Millionen Bürger gegen die Schweinegrippe impfen. Und die Bundesländer blieben auf dem Impfstoff sitzen. Nach wochenlangem Gezerre wegen der Kosten einigten sich Bund und Länder schließlich mit dem Pharmahersteller Glaxo-Smith-Kline auf eine Reduzierung der ursprünglich bestellten 50 Millionen Impfdosen auf 34 Millionen. Weil dies immer noch zuviel ist, soll ein großer Teil ins Ausland verkauft werden, was bisher allerdings noch nicht gelungen ist.
Schwachstellen bei der Pandemie-Strategie
Inzwischen ist die Grippewelle abgeebbt, das Virus aus den Schlagzeilen verschwunden. Die Gesundheitsbehörden auch in Deutschland werden sich nun mit den Schwachstellen bei der Pandemie-Strategie wie etwa der Informationspolitik oder der Impfplanung, auseinandersetzen müssen - auch im Hinblick auf künftige Seuchen. Gegen die WHO waren Forderungen laut geworden, Pandemien künftig nicht nur nach der Ausbreitung des Erregers, sondern auch wieder nach dessen Gefährlichkeit zu bewerten.
Überraschend ist: Auch wenn es wenige Fälle gibt, gilt nach wie vor die höchste Pandemiestufe sechs. Der Erreger H1N1 habe "sich nicht erledigt", sagt eine RKI-Sprecherin. Auch das Europäische Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (ECDC) geht davon aus, dass das Virus weiter zirkulieren wird. Zwar halten die Experten eine weitere Welle im Frühjahr und Sommer für unwahrscheinlich, sie schließen aber kleinere Ausbrüche nicht aus.