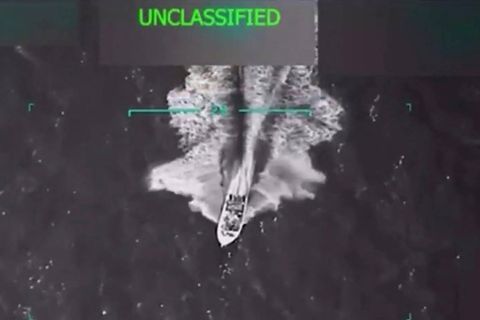Unterhalb des feuchten Sandwegs brandet der graue Atlantik gegen die Steilküste. Zwei Möwen kreischen. Ein Schaf blökt. Es ist nicht übertrieben, wenn John le Carré sagt: "Wir haben es recht ruhig hier."
Seit 40 Jahren lebt der Mann, der als David Cornwell für den britischen Geheimdienst arbeitete und später unter dem Pseudonym John le Carré ein weltberühmter Schriftsteller wurde, den größten Teil des Jahres in der meerumspülten Einsamkeit seines Landsitzes in Cornwall, im Südwesten Großbritanniens. Gerade ist sein neuer Roman erschienen, und John le Carrés Augen blitzen.
Er freut sich auf das Spiel, das jetzt beginnt: Einige wenige Journalisten dürfen ihn besuchen, zu einem ausgiebigen Gespräch in formvollendeter Gastfreundschaft. Vor Kurzem war der Kollege von der "Sunday Times" da. Und ja, das Spiel geht gut los: "Überraschendes Geständnis: Ex-Geheimagent John le Carré war kurz davor, zu den Russen überzulaufen", schreiben an diesem Tag die Zeitungen. Eine Falschmeldung. Ist er verärgert? Nein, im Gegenteil. Er amüsiert sich prächtig. Und zieht einen Brief an die "Sunday Times" aus dem Drucker, den er mit reichlich Augenzwinkern vorliest: Man möge dem Reporter seinen Fehler bitte verzeihen. Schließlich habe dieser während des Gesprächs auf ein Aufnahmegerät verzichtet und diverse Gläser Calvados genossen, da könne man schon mal etwas durcheinanderbringen. Herrlich ironisch.
Lernt man so was an der Spionage-Schule, Mr Cornwell?
Sie meinen Humor? Nun, zu meiner Zeit zeichnete sich der britische Geheimdienst durch Charme und Unterhalter-Qualitäten aus. Das gehörte zu den Grundvoraussetzungen. Auf Partys in der Botschaft erkannte man die Spione immer daran, dass sie die amüsantesten Gesprächspartner waren.
Wenn man Ihr neues Buch liest, ist die Zeit der gediegenen Gentlemen-Agenten offenbar endgültig vorbei …
… bitte, entschuldigen Sie, aber wissen Sie, was der MI6 jetzt macht? Die schalten Anzeigen! Im "Guardian"! Ist das nicht unglaublich komisch? Zu meiner Zeit wäre es eine schockierende Vorstellung gewesen, dass sich jemand darum bewirbt, dem Geheimdienst beizutreten. Die Rekrutierung lief ausschließlich über private Ansprache durch Talentsucher.
So, wie Sie es beschreiben, scheint in der heutigen Geheimdienstszene ohnehin ein ziemliches Chaos zu herrschen: Ihr Roman spielt im Hamburg der Gegenwart. Der britische Secret Service, die CIA und deutsche Ermittler rangeln um Hierarchien und Zuständigkeiten. Und vor allem die Amerikaner kommen dabei ziemlich schlecht weg.
Wissen Sie, der Kampf gegen den Terror hat auf dieser Ebene vieles verändert. Und diesem Prozess wollte ich nachgehen: Wie weit und unter welchen Bedingungen folgt ein europäisches Land dem amerikanischen Weg? Wie werden Gesetze, Verfassung und innere Sicherheit reorganisiert? Wir wird dem programmatischen Kampf gegen den Terror Rechnung getragen?
Sie erzählen von einem jungen muslimischen Flüchtling, der illegal nach Hamburg kommt. Er gerät unter Terrorverdacht und wird zum Spielball der verschiedenen rivalisierenden Institutionen. Warum lassen Sie diese Geschichte in Deutschland spielen?
Weil Ihr Land ein hervorragendes Spiegelbild für die Veränderungen ist, die mein Land schon durchlebt hat. Der Unterschied zwischen unseren Ländern - zumindest, als ich das Buch anfing - war, dass ich das Gefühl hatte, Deutschland würde sich immer noch nachhaltig dagegen wehren, dem amerikanischen Weg zu folgen, den hohen Level von Überwachung zu akzeptieren, auf dem die Amerikaner wirklich bestehen. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass Ihr Land, mit dem mich viel verbindet, absolut vor einem Scheideweg steht.
In welche Richtungen?
Ich habe jahrelang in Deutschland gelebt und vor Ort mitbekommen, wie die Bundesrepublik und ihre wundervolle Verfassung entstanden sind. Deutschland hat mehr geschützte Bürgerrechte als jedes andere europäische Land. Und viel mehr als Amerika. Die Frage ist nun, wie viel davon aufs Spiel gesetzt wird bei dem, was sich leicht als eine kolonialistische Haltung bezeichnen ließe, die offiziell aber "War on terror" genannt wird: Wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Und das betrifft auch das deutsche Geheimdienstsystem aus Verfassungsschutz, BND und BKA, das aus unserer Sicht immer ein liebenswertes Durcheinander war. Das liegt natürlich in der Geschichte begründet. Die "NZZ" bezeichnete es vor Kurzem als ewige Baustelle. Und das ist es auch. Aber jetzt ist es eine Baustelle unter massivem amerikanischem Druck.
Der Roman
Nimmt den Kampf gegen den Terror ins Visier: John le Carrés Roman "Marionetten", übersetzt von Sabine Roth und Regina Rawlinson, Ullstein, 368 Seiten, 22,90 Euro
Dieser Druck entwickelt sich in Ihrem Buch zu erschreckender Willkür. Die in Deutschland operierenden CIA-Agenten führen sich wie wild gewordene Cowboys auf. Ist das nicht ein Klischee?
Natürlich hätte ich einen amerikanischen Agenten zeigen können, der mit moralischen Problemen ringt. Aber wissen Sie, für meine Recherche habe ich mich häufig mit Murat Kurnaz getroffen - und wie es ihm ergangen ist, wissen wir. Im Grunde erzähle ich in meinem Roman, wie das läuft, wenn die CIA ihr Prinzip der "außerordentlichen Auslieferung" verfolgt. Und das geschieht eben auch in Deutschland.
Sie meinen das Prinzip, nach dem Terrorverdächtige ohne juristische Grundlage in Länder überstellt werden können, die menschenrechtsverletzende Praktiken anwenden.
Genau. Sie werden mittelalterlichen Foltermethoden ausgesetzt. Seit Beginn des "Krieges gegen den Terror" sind etwa 27 000 Personen an solche Orte verfrachtet worden. Und das ist meiner Ansicht nach ein so großes Verbrechen, dass ich dafür keine Entschuldigung finde. Deswegen habe ich bei meiner Darstellung der CIA-Agenten nicht differenziert. Wenn jemand Folter unterstützt, ist er keiner näheren psychologischen Betrachtung wert. Da gibt es keine Halbheiten. Man kann nicht ein bisschen schwanger sein. Und man kann nicht ein bisschen foltern. Abgesehen davon produziert Folter im wahrsten Sinne des Wortes deformierte Informationen sehr gefährlicher Art. Und sie fügt den Menschen unvorstellbare Schäden zu. Die Vorstellung, dass bei diesen Verhören Ärzte anwesend sind, macht mich krank.
In Ihrem Buch heißt es, nach dem 11. September habe es zwei Ground Zeros gegeben: einen in New York, wo der Anschlag passiert ist, und einen in Hamburg, wo er nicht verhindert wurde.
Ja. Es gibt diese Verrückten, die uns wegbomben wollen. Die Gefahr ist real. Aber was wir zur Abwehr aufs Spiel setzen, ist zu wertvoll. Es ist unsere Demokratie. Unsere Rechtsstaatlichkeit. Erinnern wir uns doch mal an den Nordirland-Konflikt. Das war eine schreckliche Zeit. Terror gehörte zum Alltag, Hunderte von Menschen sind gestorben. Aber unsere Einstellung war: Zum Teufel mit den Terroristen! Wir fahren trotzdem mit der U-Bahn, wir gehen weiter ins Kino. Wir lassen unser normales Leben davon nicht einschränken. Jetzt, mit dem "neuen Terror", ist dieser Wille abhandengekommen. Und erschreckend viele persönliche und gesetzliche Freiheiten dazu. Selbst meine kleine Lokalregierung hier in Cornwall könnte mein Telefon abhören. Man kann sich in diesem Land nicht bewegen, ohne 50-mal fotografiert zu werden. Und Deutschland geht jetzt auch diesen Weg.
Heißt das, die Methoden der Geheimdienste sind überzogen?
Es gibt viele wundervolle Beweise für das, was schiefläuft. Erinnern Sie sich an "Curveball"? Das war der Deckname eines irakischen Ingenieurs in Bayern, der als Informant angeheuert worden war. Er hatte gelernt, dass er besser behandelt wird, wenn er sich interessant macht. Und so fing er an, die Geschichte von mobilen Biowaffen-Laboren im Irak zu verbreiten. Der BND hat ihn damals sehr geschickt behandelt. Sie wussten, dass der Mann halb verrückt ist. Und sie schrieben auf den Report: "Mit großer Vorsicht zu genießen!" Die Warnung verschwand, als der Bericht die Amerikaner erreichte. Und "Curveballs" Aussagen wurden zur Basis für Colin Powells Report über irakische Biomassenvernichtungswaffen. Eine tragikomische Geschichte über den sogenannten Intelligence Service.
Wenn man jetzt mal von Verschwörungstheorien absieht - wie kommen solche Pannen denn zustande?
Als Mitarbeiter der geheimen Welt ist es ungemein schwierig, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Wenn man eine Information erhält, die auf Mikrofilm gespeichert und in einer Wassermelone geliefert wird, dann fühlt man sich sehr wichtig. Und die Information kommt einem höchst aufregend und wertvoll vor. Das Geheimnisvolle geriert eine Aura, der man verfällt. Und Dinge, die eigentlich ganz logisch sind, geraten in den Hintergrund. Seit dem 11. September gibt es eine neue Aristokratie von Leuten, die einen Kult um geheime Informationen und Überwachung begründet haben. Und sie werden ungeheuer wichtig genommen. Dabei würde ich gern wissen, welche Geldsummen seit dem 11. September für falsche Informationen ausgegeben wurden. Gigantische Summen. Also: Warum in aller Welt sollten wir diesen Geheimdiensten noch trauen?
… fragt der Mann, der berühmt dafür ist, als Geheimagent gearbeitet zu haben, und seit 30 Jahren immer wieder über diese Szene schreibt? Sie mochten doch Ihre Arbeit beim Secret Service.
Ich bin damals von England in die Schweiz gegangen und wurde absurd früh, mit Anfang 20, vom Geheimdienst angeworben. Eine Zeit lang habe ich dort meine Heimat gefunden. Die Arbeit entsprach meinem widersprüchlichen Charakter. Und sie entsprach der kreativen Seite meines Lebens. Ich fing an zu schreiben, als ich dem Geheimdienst beitrat. Weil es in gewisser Weise meinen Geist geöffnet hat für die Möglichkeit, Figuren zu erfinden und menschliches Verhalten zu studieren.
Hatten Sie das Gefühl, etwas Gutes zu tun?
Zu der Zeit? Ja. Ich fühlte mich wie ein großer Pfadfinder. Ich bin 1931 geboren und gehöre einer Generation an, die zu jung war, um im Krieg zu kämpfen, aber die all die Propaganda mitbekommen hatte. Am Geheimdienst lässt sich die Psychologie eines Landes ablesen. Wovor es am meisten Angst hat. Was es sich erträumt.
Was hat Ihnen das Spionieren gegeben?
Würde. Zuflucht.
Zuflucht?
Ja. Ironischerweise. Einen sicheren Ort. Und das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Einer besonderen Familie anzugehören, was sehr wichtig für mich war.
Hatten Sie nie moralische Probleme damit, sich mit Leuten anzufreunden und sie dann auszuspionieren?
Die Leute, die man benutzt als das, was die Chinesen "kleine Schiffe" nennen - zu denen hat man nur eine konstruierte Beziehung. Leute betrügen ihr Land aus tausend verschiedenen Gründen. Sie gehen Freundschaften mit dir ein aus tausend verschiedenen Gründen. Und natürlich begreift man den Prozess der Selbstkorrumpierung. Man spürt, dass man sich prostituiert für eine Sache, die gut sein muss. Ich denke, man entwickelt ein System, mit dem man natürliche moralische Bedenken abschüttelt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht zum normalen Verlauf des Lebens gehört. Spionieren ähnelt dem normalen Leben.
Sie haben oft gesagt, Spionieren sei sehr nah am Geschichtenerzählen, was wiederum sehr nah am Lügen sei - und das mögen Sie. Auf der anderen Seite haben Sie vier Söhne. Wie haben Sie denen beigebracht, dass Lügen keine gute Sache ist?
Die ganze Erfahrung von Vaterschaft war für mich eine Reise ins Unbekannte. Ich hatte keine wirklichen moralischen Vorbilder.
Ihre Mutter verließ die Familie, als Sie fünf Jahre alt waren. Ihr Vater war eine zwielichtige Figur …
… ein Hochstapler, ja, kein wirklicher Vater. Die meiste Zeit meiner Kindheit und Jugend habe ich in Internaten verbracht. Selbst die Ferien. Und ich glaube, was wirklich passiert ist, ist, dass meine Jungs mich erzogen haben. Rückblickend waren sie die moralischen Wegweiser viel Zuneigung und Unterstützung zu erfahren.
Wir haben jetzt so viel über die neue Macht der Geheimdienste im Kampf gegen islamistisch motivierten Terror gesprochen. Was sollte Ihrer Meinung nach anders gemacht werden?
Es gibt Gefahren, und die möchte ich nicht kleinreden. Aber statt Angst zu schüren und Fronten zu bilden, sollte man sich auf Diplomatie besinnen. Der Irankonflikt ist ein gutes Beispiel für eine Situation, die durch gute Diplomatie geheilt werden kann. Dadurch, dass man wartet und redet. Das Land ist in den Händen eines sehr problematischen Mannes. Aber Menschen, von denen ich weiß, dass sie sich auskennen, gehen davon aus, dass es verhandelbare Positionen gibt. Ich denke, es muss möglich sein, Gespräche zu führen und dabei auch eine Reduzierung der israelischen Streitkräfte in Betracht zu ziehen. Das kommt allerdings fast schon einer Gotteslästerung nahe. Aber hinter der Unterteilung der Welt in gute und böse Länder steckt noch etwas anderes.
Was denn?
Um es mal so zu sagen: Die Amerikaner haben keinen großen Respekt vor der nationalen Psyche anderer Völker gezeigt. Weil sie grundsätzlich denken, dass jeder so sein will wie die Amerikaner. Das halte ich, gelinde gesagt, für ein Problem.
Ein Problem der Bush-Regierung?
Das werden wir sehen. Ich hoffe, dass Amerika wieder seinen Verpflichtungen gegenüber dem internationalen Recht und den Genfer Konventionen nachkommen wird. Das amerikanische Volk wird sich dann auf seinen schwer erkämpften Respekt gegenüber menschlicher Gerechtigkeit zurückbesinnen. Und die amerikanische Exekutive auf ihre Verantwortung.