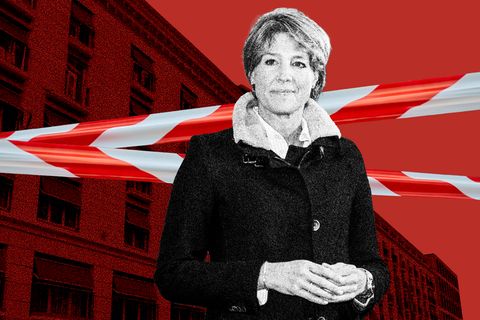Der "Club of Rome" rechnet wegen des Klimawandels mit steigenden Ausgaben für die Beseitigung von Umweltschäden. Die Kosten könnten auf bis zu 20 Prozent des Bruttosozialprodukts steigen, "wenn wir jetzt nicht umsteuern" sagte Max Schön, Präsident des deutschen "Club of Rome" im ZDF. Der Club of Rome ist ein internationaler, politisch unabhängiger Zusammenschluss von Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft. Er wurde 1968 in Rom gegründet - mit dem Ziel, Verständnis für die dringlichsten Probleme der Erde zu wecken.
Agentur plädiert für Atomkraft
Die Atomkraft kann nach Ansicht der Internationalen Energieagentur (IEA) einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Vermeidung von Treibhausgasen leisten. Das erklärte die IEA in ihrem in London veröffentlichten Weltenergieausblick 2006.
Es ist das erste Mal, dass die in den 70er Jahren gegründete IEA so entschieden für die Atomenergie plädiert. Energieeinsparungen und der Einsatz von Atommeilern könnten den Verbrauch von Primärenergie bis 2030 um zehn Prozent verringern. Das entspreche dem derzeitigen Energieverbrauch Chinas. Die weltweiten CO2-Emissionen würden im selben Zeitraum um 16 Prozent geringer ausfallen, was dem Schadstoffausstoß der USA und Kanadas entspreche.
Der Bericht wurde zeitgleich zum UN-Klimagipfel in Nairobi veröffentlicht, der seit Montag über Schritte gegen die drohende Klimakatastrophe berät. Die etwa 5000 Vertreter aus 189 Ländern diskutieren auch über eine Nachfolgeregelung des 2012 auslaufenden Kyoto-Protokolls von 1997. Darin haben sich 35 Industrienationen verpflichtet, ihren Ausstoß an Schadstoffen aus der Verbrennung fossiler Stoffe wie Öl und Gas um fünf Prozent unter das Niveau von 1990 zu senken.
Der Erde droht laut IEA in 25 Jahren eine drastische Energie-Knappheit. Um diese zu verhindern, müssten die Regierung weltweit ihre Investitionen in die Versorgungsnetze deutlich erhöhen, erklärte die IEA. Bis 2030 werde sich der weltweite Energie-Bedarf um 53 Prozent erhöhen. Der Anstieg gehe vor allem auf Entwicklungsländer wie China und Indien zurück.
"Es gibt Alternativen"
Wenn der Energieverbrauch nicht sinke, werde "die Energieversorgung in Zukunft schmutziger, unsicher und teuer sein", warnte die Agentur. Es seien aber Alternativen möglich, die zu einer sauberen und intelligenten Energieversorgung führen könnten, die vom Wettbewerb geprägt sei.
Umweltamt plädiert für Reduktion von Treibhausgasen
Die Industrieländer sollten den Ausstoß von Treibhausgasen von 2013 an bis ins Jahr 2050 jährlich um etwa vier Prozent vermindern. Das hat der Präsident des Bundesumweltamtes, Andreas Troge, in einem Interview des "Wiesbadener Kurier" gefordert. Würde global nichts Einschneidendes bei der Reduktion dieser Emissionen geschehen, drohten bis 2050 jährliche Folgekosten von 27 Milliarden Euro. In jedem Falle sei ein Fahrplan für Verhandlungen über ein Nachfolge-Abkommen des Kyoto-Protokolls erforderlich. Von der UN- Klimakonferenz in Nairobi könne ein erstes Signal dafür ausgehen.
Auch in Deutschland sei die Lage schon ernst, sagte Troge. Bis zum Jahr 2100 rechneten Fachleute für den Nordosten und den Südwesten des Landes mit bis zu 30 Prozent weniger Niederschlägen. Trockenperioden wie in diesem Sommer könnten künftig Normalität werden. Die Temperaturen könnten zwischen zwei und drei Grad steigen.
Das Problem
Grund für die Erwärmung ist der so genannte Treibhauseffekt. Treibhausgase wie Kohlendioxid lassen das kurzwellige Sonnenlicht nahezu ungehindert zur Erdoberfläche strahlen, die langwelligere Wärmestrahlung, die von der Erdoberfläche zurückgestrahlt wird, wird von ihnen hingegen reflektiert. Die Temperaturen steigen. Einzudämmen ist dieser Effekt nur, wenn die Konzentration an Treibhausgasen reduziert wird.
Der bereits fühl- und messbare Temperaturanstieg wird Forschern zufolge weiter anhalten - und eine ganze Reihe katastrophaler Nebenwirkungen auslösen. Allen voran steht der befürchtete Anstieg des Meeresspiegels, der durch das Abschmelzen großer Eismassen an den Polen und in Grönland hervorgerufen werden kann. Forscher rechnen damit, dass bis zum Jahr 2100 Normalnull um einem Meter über dem heutigen Stand liegen wird. Schon in wenigen Jahrzehnten könnten weltweit weite Teile heutiger Küstenstriche unter Wasser liegen. Die globale Erwärmung und die Eisschmelze bilden dabei einen Teufelskreis: Das tauende Eis setzt Methan frei, das als Treibhausgas wiederum die Erwärmung verstärkt.
Eine weitere, kaum kalkulierbare Gefahr liegt in der Verringerung des Salzgehalts durch die Eisschmelze. Die maritimen Strömungssysteme (Golfstrom, El Niño) könnten durch die Veränderung signifikant beeinflusst werden. Für Mitteleuropa wäre ein Aussetzen des Golfstroms, dessen Wärmeleistung der von 1 Million Kernkraftwerken entspricht, eine Katastrophe. Andere prognostizierte und zum Teil heute schon messbare Wetterveränderungen sind große, lang anhaltende Dürren und immer stärkere Stürme, die in vielen Gegenden eine Flucht in bewohnbare Gegenden auslösen könnten. FTD
Die Verursacher
Kohlendioxid (CO2) gilt derzeit als größter Klimakiller. Das Gas wird vor allem beim Verbrennen fossiler Brennstoffe wie Öl, Gas oder Kohle freigesetzt. So sind es vor allem die Industrienationen, die mit ihrem Energiehunger die Klimaerwärmung befeuern. Allen voran die USA: Die größte Wirtschaftsnation der Erde ist für 24,3 Prozent des weltweiten CO2-Ausstosses verantwortlich. Auf den Plätzen liegen die Europäische Union (15,3 Prozent), China (14,5 Prozent), Russland (5,9 Prozent) und Indien (5,1 Prozent) - allerdings mit absehbar starken Wachstumsraten in den drei letztgenannten Ländern.
Andere Treibhausgase sind Wasserdampf - der allerdings vom Menschen kaum zu beeinflussen ist -, Methan, Distickstoffoxid (Lachgas) und Fluorkohlenwasserstoffe, die früher als Treibmittel für Sprühdosen eingesetzt wurden. Heute ist der FCKW-Ausstoss allerdings deutlich zurückgegangen.
Der Treibhauseffekt ist übrigens auch dafür verantwortlich, dass wir nicht alle im ewigen Eis leben müssen: Ohne seine dämmende Wirkung würde die Durchschnittstemperatur auf der Erde bei minus 18 Grad Celsius liegen. FTD
Die Opfer
Eigentlich gibt es keine Gewinner bei einer Klimakatastrophe. 70 Prozent der Menschheit lebt direkt am Wasser oder in Küstennähe. Es sind damit rund 4,5 Milliarden Menschen, die von einem Anstieg des Meeresspiegels unmittelbar betroffen wären. Potenziert wird die Gefahr durch die Ballung großer Menschenmassen in relativ kleinen Gebieten wie in New York, Los Angeles, Hongkong, Schanghai, Tokio, Rio de Janeiro, Jakarta oder Manila. Diese Megacities reagieren extrem sensibel auf äußere Einflüsse und sind auf das reibungslose Funktionieren ihrer Infrastruktur angewiesen. Schon kleinere Störungen verursachen Milliardenschäden. Eine Flut in einem Wirtschaftszentrum wie New York hätte Folgen für die gesamte Weltwirtschaft.
Wegen seiner schlechten Infrastruktur und ungenügenden Warnsystemen ist Afrika besonders gefährdet. 30 Prozent der Küsteninfrastruktur des Kontinents könnten einer neuen Studie zufolge durch den Anstieg des Meeresspiegels und die zunehmende Zahl extremer Stürme in den nächsten Jahren unter den Fluten verschwinden. Ebenfalls zu den Hochrisikogebieten gehören Staaten, die nur knapp über dem Meeresspiegel liegen. Neben zahlreichen Inselnationen vor allem im Pazifik sind dies Bangladesch, die Niederlande und Teile Südamerikas.
Der Klimawandel führt nicht nur vor Ort zu Problemen. Millionen Menschen wären plötzlich heimatlos - und auf der Suche nach einem neuen Lebensraum. Die Umweltmigration gilt deswegen als eines der größten sozialen und politischen Risiken der kommenden Jahrzehnte. FTD
Das Kyoto-Protokoll
Seit 1997 soll das so genannte Kyoto-Protokoll, ein Zusatzprotokoll zur Ausgestaltung der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) der Vereinten Nationen, die Treibhausgasemissionen bis 2012 auf ein Niveau von 5,2 Prozent unter dem Stand von 1990 beschränken. In Kraft getreten ist das Protokoll jedoch erst 2005, nachdem durch die Ratifizierung Russlands alle Bedingungen (Die Unterzeichnerstaaten müssen zusammen 55 Prozent des CO2-Austosses verursachen und es müssen mindestes 55 Staaten das Abkommen ratifiziert haben) erfüllt waren. Im Protokoll sind Ausnahmen für China, Indien, Russland, die Ukraine und zahlreiche Entwicklungsländer vorgesehen. Zudem können die Länder über den Handel mit Emissionszertifikaten Verschmutzungsrechte einkaufen. Vorhandene CO2-Senken wie Wälder dürfen in der Bilanz gegengerechnet werden.
So haben zahlreiche Länder ihre tatsächlichen Emissionen trotz Ratifizierung des Abkommens in den vergangenen Jahren drastisch erhöht. Spanien (plus 42 Prozent von 1990 bis 2003), Portugal (plus 37 Prozent), Griechenland und Irland (jeweils plus 26 Prozent), Finnland (plus 22 Prozent), Österreich (plus 17 Prozent) und die USA (plus 13 Prozent). Deutschland konnte seine Emissionen in diesem Zeitraum um 20 Prozent senken. Dies hing aber weniger mit einer besonders durchschlagenden Umweltpolitik zusammen als mit der Tatsache, dass nach der Wiedervereinigung zahlreiche besonders emissionsintensive Betriebe der ehemaligen DDR geschlossen wurden.
Die USA, Australien und Kroatien ratifizierten das Protokoll nicht. Vor allem die US-Regierung unter George W. Bush tat bislang wenig für die Eindämmung der Treibhausgasemissionen. Argumentiert wurde stets mit den negativen Folgen für die Wirtschaft. Inzwischen ist aber auch in den USA das Bewusstsein für den Klimawandel gewachsen, die Verweigerungshaltung der Washingtoner Eliten stößt auf Widerstand - zum Teil auch in der eigenen Partei, wie die umweltpolitische Zusammenarbeit des republikanischen Senators in Kalifornien, Arnold Schwarzenegger mit dem britischen Premierminister Tony Blair. FTD
Wirtschaftliche Folgen
Der ehemalige Chefökonom der Weltbank, Nicholas Stern, berechnete jüngst in einer Studie für die britische Regierung die Folgen des Klimawandels für die Weltwirtschaft. Es war das erste Mal, dass ein profilierter Wirtschaftswissenschaftler sich des Themas annahm. Seine Schlüsse sind alarmierend: Um 5 bis 20 Prozent würde demnach das Bruttosozialprodukt sinken, wenn die Politik der Erwärmung weiter tatenlos zusieht. Das würde eine globale Depression bedeuten, die um einiges heftiger ausfallen würde als die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren. Umgekehrt würden die Maßnahmen, die erforderlich wären, um die gröbsten Schäden zu verhindern, nur ein Prozent des Bruttosozialprodukts kosten.
Stern sieht aber auch Chancen in der Adaption an die veränderte Umwelt: So könne der Markt für umweltfreundliche und emissionssenkende Produkte und Technologien in Zukunft ein Volumen von mehreren Hundert Milliarden Dollar pro Jahr erreichen. Schon heute verzeichnen umweltorientierte Unternehmen in Deutschland, einem Vorreiter in Sachen Klimaschutz, mit die größten Wachstumsraten. Auch die Aktienkurse reagieren bereits auf eine umweltgerechte Unternehmenspolitik: Einer neuen Studie zufolge liegt er bei Konzernen mit ausgewiesenem Nachhaltigkeitsmanagement bis zu acht Prozent höher als bei der Konkurrenz. FTD