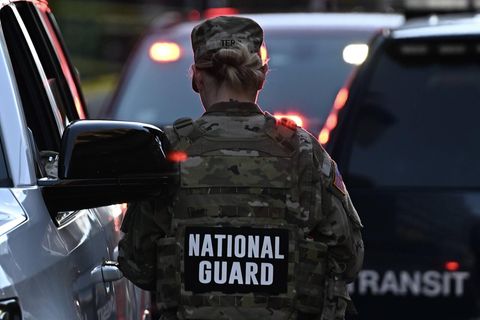Der neue Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger Franz Josef Jung (CDU) Verständnis dafür gezeigt, dass in Afghanistan eingesetzte Bundeswehrsoldaten von "Krieg" sprechen. Zwar schränkte der Minister ein, dass die Wortwahl juristisch nicht passt. Doch Guttenbergs Verständnis schaffe gleichwohl ein Stück mehr "Rechtssicherheit für die Soldaten", hofft der Völkerrechter Michael Bothe. Staatsanwälte, die "Tötungshandlungen" von Einsatzsoldaten bislang nach Polizeirecht überprüfen, könnten von der Haltung des Ministers durchaus beeindruckt sein, glaubt der Frankfurter Rechtsgelehrte.
Ebenso wie Bothe verweist Jochen von Bernstorff vom Max Planck Institut (MPI) für Völkerrecht in Heidelberg darauf, dass der Begriff des Krieges aus der Sprache des Völkerrechts weitgehend verdrängt wurde, weil er nur die Feindseligkeiten zwischen Staaten beschreibt. Stattdessen sprechen die Experten heute von einem "bewaffneten Konflikt". Darunter wird allgemein der "Austausch militärischer Feindseligkeiten mit einer bestimmten Intensität" verstanden, wie Hans-Joachim Heintze vom Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) an der Ruhr-Universität Bochum erläutert. Zudem seien auf beiden Seiten militärische Strukturen notwendig.
Ob sich die Bundeswehr im Norden Afghanistans bereits in einem "bewaffneten Konflikt" und damit umgangssprachlich im "Krieg" befindet, ist nicht allein eine Frage der politischen Einschätzung: Laut Völkerrecht liegen bewaffnete Konflikte vor, wenn es bei Einsätzen zu mehr als nur sogenannter niedrigschwelliger Gewalt kommt.
Diese Schwelle ist laut Bothe und anderen Völkerrechtlern angesichts der zunehmenden Kampfhandlungen in Afghanistan bereits überschritten. Mit paradoxen Rechtsfolgen für die deutschen Soldaten: Bei Einsätzen unterhalb der Schwelle zum bewaffneten Konflikt gilt das Polizeirecht, wenn beurteilt werden soll, ob Todesopfer unter Zivilisten strafrechtlich verfolgt werden müssen. Nach Polizeirecht wäre der von der Bundeswehr angeforderte NATO-Luftangriff in Kundus wegen der zivilen Todesopfer laut Bothe nicht gerechtfertigt.
In einem bewaffneten Konflikt allerdings schon: "Schädigungshandlungen" sind Bothe zufolge grundsätzlich zulässig, wenn sie einem militärischen Ziel dienen. "Und solch ein Ziel liegt immer dann vor, wenn sich auf der anderen Seite Kämpfer befinden". Bei deren Bekämpfung könnten selbst zivile Opfer in Kauf genommen werden, solange es nicht "übermäßig viele" sind und das Einsatzmittel dem Ziel angepasst ist, sagt der Völkerrechtler. "Die Frage, ob die Bundeswehr in einen bewaffneten Konflikt verstrickt ist oder nicht, ist insoweit keine der Semantik: Es geht vielmehr um die Soldaten, die angemessen geschützt sein müssen, bei dem was sie tun", sagt Bothe.
Dieser Rechtsschutz hängt allerdings nicht davon ab, dass ein bewaffneter Konflikt formal erklärt oder festgestellt wird: Sollte ein Bundeswehrsoldat etwa wegen Straftaten während des Afghanistan-Einsatzes vor Gericht stehen, entscheiden allein die Richter, ob der Soldat im Rahmen eines Polizeieinsatzes oder eines bewaffneten Konflikt handelten, sagt Bothe. "Ein deutscher Staatsanwalt, der Straftaten verfolgt und anklagt wird die Auffassung der Bundesregierung allerdings mehr beachten", fügt Bothe hinzu.
So betrachtet, könnte Guttenbergs Verständnis auch als hilfreicher Wink im Fall von Oberst Georg Klein gesehen werden. Weil er den Luftangriff auf die zwei von Taliban entführte Tanklaster in Afghanistan angeordnet hatte, prüft nun die Staatsanwaltschaft in Leipzig, ob gegen den Soldaten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung von Zivilisten eingeleitet wird.