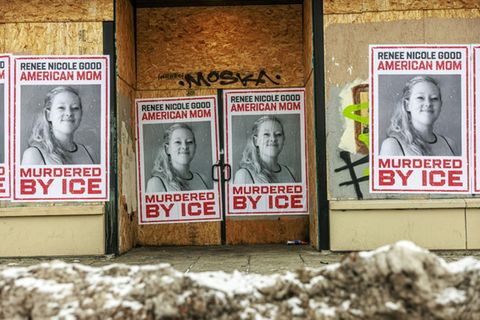Der philippinische Delegierte Yeb Sano war am ersten Tag der Klimakonferenz in Warschau, dem 11. November, in den Hungerstreik getreten, um damit auf ein "bedeutendes Ergebnis" bei den Verhandlungen zu dringen. Der Diplomat sieht im Klimawandel die Ursache für den verheerenden Taifun "Haiyan", der kurz vor Beginn der Warschauer Verhandlungen schwere Verwüstungen auf den Philippinen angerichtet hatte. Mehr als 5200 Menschen wurden durch das Unwetter getötet.
Doch nach tage- und nächtelangem Ringen hat die Weltklimakonferenz in Warschau nur einen Minimalkonsens erreicht. Es gibt einen Zeitplan für die Arbeit am Weltklimavertrag, der 2015 in Paris abgeschlossen werden soll. Wie rechtlich verbindlich die Klimaschutzziele einzelner Länder sein werden, wurde jedoch nicht festgelegt. Beim Thema Finanzen gab es wenig konkrete Zusagen. Der amtierende Bundesumweltminister Peter Altmaier gab sich optimistisch: "Die Vereinbarungen ermöglichen es uns, weiter voranzuschreiten auf dem Weg in Richtung auf ein umfassendes Klimaabkommen."
Über das Ergebnis der Klimakonferenz zeigte sich Sano aber enttäuscht. Es sei nicht das herausgekommen, was er als bedeutendes Ergebnis bezeichnet hätte, sagte er. "Aber ich habe auch gesagt, ich werde für die Dauer der Konferenz hungern. Die Konferenz geht zuende, also kann ich essen." Sano wollte mit dem Hungerstreik auch Solidarität mit den Taifunopfern in seiner Heimat bekunden.
Schwacher "Warschauer Mechanismus"
Um Schäden und Verluste durch die Erderwärmung in armen Ländern auszugleichen, schuf die Konferenz den "Warschauer Mechanismus", doch der ist noch sehr unkonkret. "Wieder waren wir diejenigen, die sich zurückbeugen mussten", meinte der philippinische Delegierte Yeb Sano. Bis kurz vor Schluss am Samstagabend hatten ärmere Staaten letztlich erfolgreich darum gekämpft, dass dieser Punkt künftig nicht auf einer unteren Konferenzebene verhandelt wird. "Angesichts des Taifuns Hayan und anderer Katastrophen halten wir den Mechanismus für ein schwaches Ergebnis", sagte Thomas Hirsch von Brot für die Welt. Es sei aber ein positives Zeichen, dass die EU und die USA sich zum Ende noch auf die Entwicklungsländer zubewegt hätten.
Ein neuer Fahrplan zum Aufbau eines Grünen Klimafonds soll ermöglichen, dass die Industrieländer bereits vom nächsten Jahr an Geld darin einzahlen können. Daraus sollen ärmere Länder einmal Geld für ihre klimafreundliche Entwicklung und die Anpassung an die Klimaschäden erhalten.
Keine weiteren konkreten Zusagen gaben die Industrieländer zum zuvor schon beabsichtigten Anstieg ihrer Klimahilfen bis auf 100 Milliarden US-Dollar (74 Milliarden Euro) jährlich im Jahr 2020. Einige Industrieländer, darunter Deutschland, gaben zusammen jedoch 100 Millionen Dollar für einen kleineren, schon bestehenden Anpassungsfonds, der auszutrocknen drohte.
Trippelschritt auf dem Weg nach Paris
Vertreter von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, die die Konferenz am Donnerstag unter Protest verlassen hatten, zeigten sich enttäuscht. "Der derzeitige Text über Finanzen ist nichts als eine Übung in sprachlicher Yoga", sagte Oxfam-Direktorin Winnie Byanyima in einer Stellungnahme. "Warschau war höchstens ein Trippelschritt auf dem Weg nach Paris", sagte Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Ein Grund seien die EU und Deutschland, die nahezu vollständig auf ihre frühere Vorbildfunktion verzichtet hätten.
Ein Lichtblick für die Konferenz ist dagegen ein Rahmenpapier für den Waldschutz. Darin wird festgelegt, unter welchen Bedingungen arme Länder im Rahmen der Klimaverhandlungen Geld für den Schutz ihrer Wälder erhalten können. UN-Klimachefin Christiana Figueres sagte, dies werde helfen, die Freisetzung von Kohlendioxid durch die Zerstörung der Wälder deutlich zu reduzieren. Diese trägt derzeit zu rund 20 Prozent zum menschengemachten Treibhauseffekt bei.