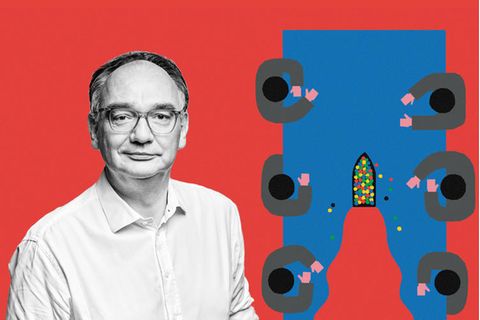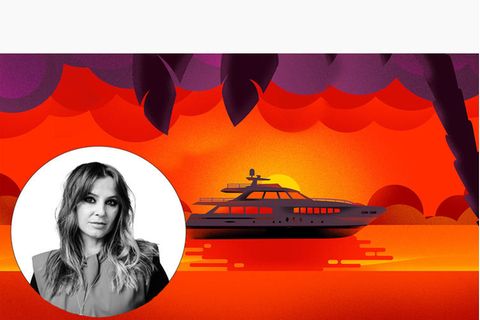Der Konflikt zwischen Serben und Albanern um das Kosovo ist auch nach mehr als zwei Jahren Verwaltung durch die Vereinten Nationen einer Lösung fern. Die dort seit dem Ende der NATO-Luftangriffe gegen Jugoslawien stationierten Friedenstruppe KFOR verhindert aber den Ausbruch größerer Gewalt. Die Vertreibung Zehntausender Serben und tödliche Anschläge hat sie nicht unterbunden.
1999 hatte sich die NATO entschlossen, auf Seite der Kosovo-Albaner gegen die Belgrader Führung in den Konflikt einzugreifen. Zu diesem Zeitpunkt zählten internationale Flüchtlingshelfer bereits mehrere Hunderttausend kosovo-albanische Binnenvertriebene in einem Guerillakrieg zwischen UCK-Rebellen und den Truppen Belgrads.
Die für das Ende des Krieges verabschiedete UN-Resolution 1244 sieht vor, der Provinz Autonomie und Selbstverwaltung innerhalb Jugoslawiens zu geben. Die Grundlage dazu sollen die Wahlen am 17. November mit einem frei gewählten Parlament, einer eigenen Regierung und einem Präsidenten schaffen. Diese sollen weitgehende Verantwortung für die Provinz übernehmen.
Albaner bilden Bevölkerungsmehrheit
Das Kosovo gehört bis zur Klärung des endgültigen Status weiter zur Bundesrepublik Jugoslawien, auch wenn es de facto schon viele Züge eines eigenen Staates trägt. Die mehr als zwei Millionen Einwohner sind überwiegend Albaner. Zu den Wahlen sind mehr als 170 000 Serben registriert, die fast alle als Flüchtlinge leben.
Die Provinz, etwa halb so groß wie Hessen, ist ländlich strukturiert und galt trotz reichlich vorhandener Bodenschätze als das Armenhaus Jugoslawiens. Internationale Hilfe und Investitionen der Kosovo-Albaner in ihre Privatwirtschaft haben seit dem Krieg vielerorts zu einem erkennbaren Aufschwung geführt.