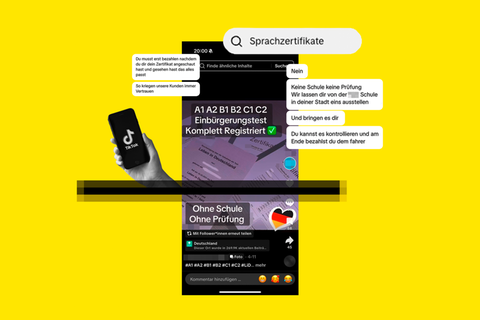Ahmet Özdemir ist ein Kind türkischer Migranten. Geboren wurde er in Deutschland; in der Nähe von Aachen. Im Alter von 39 Jahren blickt er zurück: Ist er wirklich integriert in seinem Geburtsland? Oder bleibt er ein Wanderer zwischen den Welten? Der Familienvater beschreibt, wie sich Integration in Deutschland anfühlt.
Schon früh wusste ich: Das Erlernen der deutschen Sprache ist ein Muss für das erfolgreiche Leben in Deutschland. Kannst du es, gehörst du dazu!
Gesagt, getan. Ich war sehr bemüht, nur deutsch zu sprechen, deutsch zu denken und auch viel in dieser Hinsicht zu schreiben und zu kommunizieren.
Dabei war in meiner Familie kaum eine Basis für das Erlernen der deutschen Sprache vorhanden. Meine Eltern konnten es nicht und meine Geschwister waren damit beschäftigt, selbst voranzukommen, ohne eine Unterstützung der Eltern.
Schon der Weg der Grundschulzeit war ein steiniger (...). Migranten, Ausländer wurden sortiert, konnten kein Deutsch – waren anders –, und die Blicke der deutschen Eltern waren oft merkwürdig. "Wie – mein Kind mit so vielen Migrantenkindern in einer Klasse?" Später habe ich Sätze wie diese auch von Kollegen gehört, die ihre Kinder nicht in Klassen haben wollten, in denen der Ausländeranteil zu hoch war.
Wie weit sollte ich gehen?
Aber was heißt Integration überhaupt? Was bedeutet dieses Wort? Jeder hatte einen anderen Bezug und auch eine andere Erwartung zu diesem Thema – ein sehr dehnbarer Begriff, ohne dass ein vollständiger Lösungsansatz vorhanden war. Sprechen konnte jeder darüber, aber anpacken war wohl nicht jedermanns Stärke!
Wollte ich mich denn wirklich anpassen, mich integrieren und dazugehören? Und wenn ja, wie viel, wie sehr und vor allem: zu welchem Preis?
Ich machte mich auf die Suche nach einem Leben in Deutschland, bei dem ich von der Gesellschaft akzeptiert würde. Ich hatte große Ziele. Aber würde dies auch bedeuten, dass ich in die Kirche ging, vielleicht sogar Schweinefleisch aß? Sollte ich mir das antun? Und was war das Besondere an der deutschen Kultur?
Auf der anderen Seite war es wichtig, die deutsche Kultur nicht nur ansatzweise kennenzulernen und anzunehmen. Schließlich hatten wir uns für dieses Land entschieden!
In der Vergangenheit war eine erfolgreiche Integration gescheitert. Die Politik hatte versagt, die Hilfsbereitschaft der Deutschen hatte versagt, die Migranten hatten versagt. Aber gelingt Integration denn wirklich aufgrund der politischen Unterstützung und durch die Hilfsbereitschaft anderer?
"Irritiert statt integriert - Das Leben in Deutschland"
Der Text fasst die zentralen Gedanken des Buches vin Ahmet Özdemir zusammen. Erschienen ist es im Shaker Verlag, Aachen.
Ein Wanderer zwischen zwei Welten
Im Laufe meines Lebens lernte ich jedoch, wie schwer diese Ziele umzusetzen waren. Probleme zu identifizieren, um mich frei bewegen und die andere Seite des Lebens annehmen zu können, mich damit anzufreunden und anzupassen, meinem "neuen" Leben einen Namen zu geben, war für mich eine extrem große Umstellung. Sie war mit erheblichen Problemen und Schwierigkeiten verbunden – und es kam alles ganz anders, als ich es mir erhofft und erträumt hatte.
Der 360-Grad-Blick zeigte mir bald, dass eine Integration nicht gleich eine Integration ist. Das deutsche Leben war anders, christlich eben. Da fehlte den Türken schlichtweg der Bezug! Wie wollte oder sollte der Türke sich hier anpassen oder integrieren? Wenn vorab schon Vorurteile entstanden? Es konnte nicht gelingen, dass die Türken sich etablieren, sich in dem Land, in dem sie Steuern bezahlen, festigen, in einem Land, das zudem so fern von den Traditionen der türkischen Gesellschaft ist.
Was dazwischenkam, war das Fremde, das Andere, das Unerkennbare! Vielleicht auch die Sehnsucht oder auch die Enttäuschung.
Für mich wurde schnell offensichtlich, dass Integration kein Thema des Wollens oder Nicht-Wollens war. Vielmehr wurde das deutsche Leben so, wie es gelebt wurde, nicht angenommen. Ein Türke konnte sich mit dem deutschen Leben und mit der deutschen Kultur einfach nicht identifizieren.
Ein Wanderer zwischen zwei Welten, so kam ich mir vor. Ein Wanderer, der aber aufgrund seiner Herkunft nie akzeptiert wurde. Ein Wanderer, der seine Heimat eigentlich nicht kannte. Heimatlos auf beiden Seiten. Für den Deutschen immer der Türke, der sich nicht integrieren möchte, und von den Türken in der Türkei, im Urlaub, nie als Türke betrachtet. Dort waren wir die "Deutsch-Türken".
Die Frage nach der (Un-)Vereinbarkeit der Kulturen
Eigentlich ist es doch so einfach: Nicht die Herkunft ist entscheidend, sondern der Mensch selbst. Die Menschlichkeit der Person und die Nähe zueinander, um voneinander zu lernen. Akzeptanz und mehr Respekt füreinander wäre ein Weg, der einiges im Leben der beiden Kulturen erleichtern würde. Und vor allem würde mehr gegenseitiges Interesse den Weg der Integration vereinfachen. Sich kennenlernen wollen, sich verstehen wollen, auch wenn es Gegensätze gibt.
Was ist denn daran so schwierig, sich gegenseitig zu akzeptieren?
Und warum verweigern sich viele Migranten, insbesondere viele Türken, der Integration. Ist sie so schwer? Vor allem: Was ist so schwer an der ganzen Sache? Welche Erwartungen haben wir voneinander? Haben sich die Migranten nicht einfach anzupassen oder zu integrieren?
Also wo liegt das Problem, die Schwierigkeit der Migranten? Warum können sie nicht ansatzweise den Bedürfnissen der deutschen Kultur nachgehen? Warum können sie sich nicht "anpassen"?
Für die Deutschen bestand diese Frage schon immer: Warum ist es nicht möglich, einfach das Kopftuch abzulegen? Warum ist es so schwierig, die deutsche Sprache zu erlernen? Warum war man nicht bemüht, die deutsche Kultur, die Festtage, die Sitten, die Ge-bräuche, die Menschen mit unbeschwert kennenzulernen?
Kommen wir jemals an?
Nach wie vor ist die Bezeichnung "Gastarbeiter" in den Köpfen einiger Deutscher fest verankert. Doch solange dieses Wort verwendet und der damit verbundene Gedanke des "Gast"-Seins weiterhin aufrechterhalten wird, sehe ich die Integration in weiter Ferne.
Die ausländischen Gastarbeiter kamen und arbeiteten jahrelang – unter anderem im Bergbau, unter den härtesten Bedingungen, für sehr wenig Geld. Seit über 45 Jahren lebt die erste Migrantengeneration nun in Deutschland, und trotzdem wurde am Konzept der Integration nicht gearbeitet und nicht darin investiert. Wie konnte die Politik so versagen?
Das Positive an der ganzen Sache war, dass ich mich frei fühlte, so dass ich selber entscheiden konnte, ob ich die deutsche Kultur mag, ob ich sie überhaupt mag, ob ich mich anpassen oder auch integrieren möchte. Ob mir das Leben hier tatsächlich gefällt, ob ich mich mit den Festtagen anfreunden kann, ob ich das Leben in Deutschland auch so leben möchte.
Egal, zu welchen Differenzen es zwischen den Deutschen und den Migranten kam, egal, welche Problematiken seit Jahren existierten und welche Hindernisse oder Diskriminierungen ich erlebte: Ich lebe sehr gerne hier und das soll so bleiben! Ich fühle mich wohl, geborgen, finde die deutsche Kultur interessant, fühle mich in der Gesellschaft, die ich kenne, zu weiten Teilen gut aufgehoben und möchte hier auch bleiben. Für mich gehören Weihnachten und Ostern zu meinem Leben, ich feiere mit. Ich habe gelernt, diese Feiertage wertzuschätzen und einfach die Inhalte dieser Festtage für mich zu gewinnen.
Integration und Irritation – ein Ausblick
Ja, das Leben in Deutschland war für mich immer mit Hindernissen verbunden.
Die dummen Sprüche, die unfairen Mittel meiner Person gegenüber waren zwar nicht immer so hart gemeint, wie sie geäußert wurden, waren oft mit einem Anflug von Ironie verbunden, aber trotzdem verletzend und klar an mich, als Ausländer, als Türke, gerichtet.
Es gehört einfach viel mehr dazu: Respekt, Verständnis, Akzeptanz. Offenheit.
Zwei Zitate sind für mich ganz zentral, wenn es um den Schlüssel für ein besseres Miteinander in Deutschland geht. Sie umreißen, welche Aufgaben, welche Herausforderungen vor uns liegen. So sei für alle, welche die Muttersprache der Migranten unwichtig finden, hier Wilhelm von Humboldt herangezogen: "Die Sprache ist gleichsam die äußere Erscheinung der Völker; ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ihre Sprache, man kann sie beide nie identisch genug denken."
Und allen jungen Menschen, die ihr Leben noch vor sich haben und die entscheiden können, welchen Weg sie gehen, sei der erst kürzlich verstorbene Richard von Weizsäcker ans Herz gelegt: "Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder Türken, gegen Alternative oder Konservative, gegen Schwarz oder Weiß. Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander!"
Es gibt zwar kein Rezept gegen Vorurteile, aber es sollte mehr Menschen mit Herz, Verstand, Empathie und Nächstenliebe geben, um die Probleme unseres Lebens in Deutschland zu verringern.
Ich werde oft gefragt, ob ich integriert bin. Meine Antwort: Ich bin dann integriert, wenn mir solche Fragen nicht mehr gestellt werden.