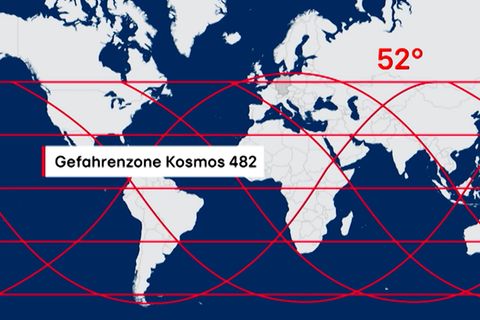Nach dem Mittagessen ergriff General Artur Nebe das Wort. Der SS-Brigadeführer sprach zu mehr als 60 Offizieren über »die Judenfrage mit besonderer Berücksichtigung der Partisanen«. Der »jüdische Bolschewismus« müsse »rücksichtslos« bekämpft werden und man dürfe Zivilisten nicht verschonen. Protokoll und Teilnehmerliste der Konferenz, die nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion östlich von Minsk stattfand, sind bis heute erhalten. Sie sind in der neuen Wehrmachtsausstellung in Berlin nachzulesen und ein Beleg für die systematische Beteiligung des deutschen Militärs an den Kriegsverbrechen zwischen 1941 und 1944.
Neuer Ansatz für die Darstellung
Nach Absetzung der ersten Wehrmachtsausstellung vor zwei Jahren haben die Ausstellungsmacher rund um Jan Philipp Reemtsma und seinem Hamburger Institut für Sozialforschung einen neuen Ansatz für die Darstellung eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte gewählt. »Wir haben uns für einen differenzierten Blick entschieden«, sagt die Leiterin des Ausstellungsteams, Ulrike Jureit.
Nicht mehr großformatige Fotos von Erschießungskommandos und Leichenbergen beherrschen die Schau »Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944« in den Berliner »Kunst-Werken« - es sind vor allem kleine Bilder und lange Texte, mit denen die Mitschuld der Wehrmacht am Holocaust und den Kriegsverbrechen im Osten und Südosten Europas dokumentiert wird. Sie widersprechen dem im Nachkriegsdeutschland gepflegten Bild einer »sauberen Wehmacht«.
In Glaskabinen können die Besucher die mörderischen Befehle oder Schilderungen von Zeitzeugen über das Wüten der Soldaten in der einstigen Sowjetunion oder in Griechenland hören.
Minutiöse Rekonstruktion
Minutiös rekonstruiert die Ausstellung die Verstrickung der Militärs in Hitlers Vernichtungsfeldzug: Von den geheimen Befehlen an das Oberkommando der Wehrmacht, im Osten keine Milde walten zu lassen, über den Einsatz der Soldaten bei der Erfassung und Verschleppung der Juden in Gettos und Konzentrationslager bis hin zum Hungertod von Millionen Sowjetbürgern im »Ernährungskrieg«.
Doch anders als die erste Ausstellung, deren Präsentation eine vom Hamburger Institut eingesetzte Historikerkommission als »zu plakativ und pauschal« kritisiert hatte, möchte die neue Schau einen Lichtblick als »Dimension der Zivilcourage« geben, wie Reemtsma sagte: Sie erzählt unter anderem die Geschichte des Oberstleutnants Josef Sibille, einem strammen NSDAP-Mitglied, der sich 1941 weigerte, jüdische Kinder und Frauen aus dem Dorf Krutscha in Weißrussland als Partisanen hinzurichten. Daraufhin übernahm ein anderer Kompanieführer, Oberstleutnant Hermann Kuhls, das Kommando und befehligte die Hinrichtung - ohne Protest.