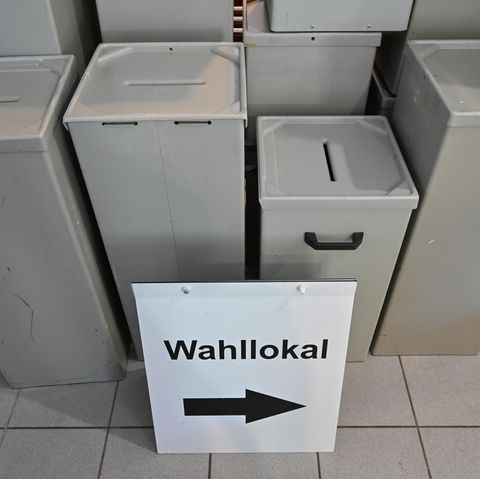Woidkes riskante Wette geht auf
Man hatte es fast vergessen: So also sehen siegreiche Sozialdemokraten aus. Um 18.15 Uhr steht Dietmar Woidke im Innenhof der sogenannten "Gaumenarche", nur 300 Meter vom Potsdamer Landtag entfernt, und lässt sich feiern. Bald 63 Jahre ist er alt und seit elf Jahren Ministerpräsident von Brandenburg: Falls sich die erste Hochrechnungen bestätigen, darf er weitere fünf Jahre in der Staatskanzlei sitzen bleiben. "Es war ein hartes Stück Arbeit!", ruft er. Noch seien die Zahlen nicht vollständig belastbar. Aber es sehe so aus, dass es wieder "wie so oft in der Geschichte Sozialdemokraten waren, die Extremisten auf ihren Weg zur Macht gestoppt haben".
Es ist Woidkes Sieg, ganz und gar. Im Sommer war er eine riskante Wette eingegangen: Er setzte nicht nur auf den alten Ich-oder-die-AfD-Amtsbonus, der schon bei den ostdeutschen CDU-Kollegen Michael Kretschmer und Reiner Haseloff oder der Mit-Sozialdemokratin Manuela Schwesig funktioniert hatte. Nein, er setzte diesmal noch einen drauf: Falls er nicht auf Platz 1 lande, stelle er sein Regierungsamt zur Verfügung, drohte er. Dann müsse ein anderer das Land regieren.
Die Ansage wirkte. Die SPD schob sich Woche für Woche näher an die AfD heran, die in Umfragen über eineinhalb Jahre teilweise mit bis zu zehn Prozentpunkten vorne gelegen hatte. Als hilfreich erwies sich dabei, dass Woidke den Wohn-Brandenburger Scholz aus dem Wahlkampf de facto verbannte. Der Kanzler durfte die Woidke-Show nicht stören.
Verschnaufpause für Scholz – aber mehr auch nicht
Es ist verdammt knapp, aber grad nochmal gut gegangen: Im Willy-Brandt-Haus, der Berliner Parteizentrale der SPD, dürfte die Erleichterung groß sein – wieder einmal. Auch die Landtagswahl in Brandenburg war eine "Schicksalswahl" für die SPD, wie mittlerweile eigentlich alle Wahlen für die strauchelnden Sozialdemokraten.
Das gibt der bemerkenswerten Aufholjagd von SPD-Ministerpräsident Woidke, der den ersten Hochrechnungen zufolge um Haaresbreite auf Platz 1 mit 31 bis 32 Prozent (2019: 26,2 Prozent) ins Ziel ging, einen bitteren Beigeschmack.
Wenn sich an den Zahlen nichts fundamental ändert, dann bleibt die rote Hochburg Brandenburg in sozialdemokratischer Hand, die SPD stärkste Kraft (seit 1990). Das dürfte dem unbeliebten Kanzler Olaf Scholz zumindest eine Verschnaufpause vom anhaltenden Geraune seiner Genossen verschaffen, ob er die SPD noch als Kanzler(kandidat) in die nächste Bundestagswahl führen kann.
Einerseits. Anderserseits macht der (mutmaßliche) Sieg in Brandenburg die mauen Ergebnisse in Sachsen und Thüringen, wo die SPD auf kümmerliche einstellige Werte zusammengestutzt wurde, und das historische Negativergebnis bei der Europawahl nicht vergessen. Der Druck auf Scholz aus seiner Partei, mehr in die Offensive zu gehen und SPD Pur durchzusetzen, dürfte unverändert hoch bleiben.
Die Krise der Ampel wird größer: Was machen Grüne und FDP?
Es läuft nicht, so gar nicht. Auch in Brandenburg sind die Grünen die Gerupften, haben ihr Ergebnis von 2019 (10,8 Prozent) praktisch halbiert. Je nach Prognose steht sogar der Wiedereinzug ins Parlament auf der Kippe.
Für Vizekanzler Robert Habeck, dem wahrscheinlichen Kanzlerkandidaten der Grünen, ist das keine gute Ausgangslage. Schon in Thüringen verpasste man den Wiedereinzug, in Sachsen ließ man auch Federn. Der Ruf der Grünen ist, zumindest in Ostdeutschland, ziemlich ramponiert. Ein klares Mandat für eine Kanzlerkandidatur, lohnt sich das noch? Vielleicht jetzt erst recht, könnte der Pragmatiker Habeck das Fingerzeig-Image seiner Partei nochmal grundlegend drehen.
Für die FDP hingegen gab es in Brandenburg zwar nicht viel zu verlieren, die Liberalen verpassten schon 2019 den Einzug in den Landtag. Diesmal jedoch wird das offenbar sehr schwache Ergebnis nicht einmal mehr einzeln ausgewiesen, sondern unter "Sonstige" gefasst. Für die strauchelnde Berliner Ampel sind die Ergebnisse der Grünen und FDP jedenfalls keine stabilisierende Maßnahme. Beide Parteien dürften nun nach Profilierungsflächen suchen, weniger Rücksicht auf die Koalitionspartner nehmen – das bedeutet im Zweifel noch mehr Unruhe in der ohnehin von Rauflust geprägten Regierung.
Die Strategie der AfD: Je stärker, umso radikaler – und umgekehrt
Für die AfD hat es offenbar nicht für Platz 1 gereicht. Doch sie ist deutlich gewachsen. Auf dem Land, aber auch in peripheren Städten wie Cottbus, ist sie klar die stärkste Kraft. Dies bedeutet: Ähnlich wie zuvor in Sachsen und vor allem in Thüringen ist die Eskalationsstrategie der Landespartei aufgegangen. Die gesamte AfD dürfte sie im Bundestagswahlkampf kopieren.
Schon unter Andreas Kalbitz wurde Brandenburg zu einem Zentrum der Rechtsextremisten in der AfD. Unter dem Spitzenkandidaten Hans-Christoph Berndt und seinem Landeschef René Springer hat sich das nicht geändert. Ihr Auftritt wirkt zwar verbindlicher als der von Kalbitz oder von Björn Höcke: Doch ideologisch sind sie ebenso völkisch und radikal aufgestellt wie sie. Die Brandenburger AfD fordert offen die millionenfache Remigration von Ausländern, will Abschiebungen privatisieren und Flüchtlingen von öffentlichen Veranstaltungen ausschließen.
Extreme Positionen, gepaart mit professionellem Auftreten: Vor allem Springer hat diese Kombination perfektioniert. Mit dem von ihm orchestrierten Netzwerk von Nachwuchspolitikern wird er den Bundestagswahlkampf mitbestimmen. Damit bleibt es beim AfD-Erfolgsprinzip: Je stärker, umso radikaler – und umgekehrt.
CDU enttäuscht: Doch die Kanzlerkandidatur ist Merz nicht mehr zu nehmen
Die Christdemokraten müssen eine bittere Niederlage verkraften: Nur 11,8 Prozent wählten die CDU, damit noch weniger als bei der letzten Landtagswahl (15,6 Prozent). Noch vor zwei Monaten lag Spitzenkandidat Jan Redmann mit Amtsinhaber Woidke gleichauf, lieferte sich bei 19 Umfrageprozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ihm – nicht einmal Redmanns Promille-Fahrt konnte etwas daran ändern. Wohl aber Woidkes Alles-oder-nichts-Strategie, der den parteipolitischen Mehrkampf zum Zweikampf gemacht hat. Die CDU hatte das Nachsehen. Nun liefert man sich mit der neu gegründeten Wagenknecht-Partei ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 3 oder 4. Autsch.
Für Friedrich Merz, den designierten Kanzlerkandidaten der Union, der sich am Montag offiziell vom Parteivorstand küren lassen will, ist das ein denkbar schlechter Start. Er muss die Niederlage kommentieren, erklären, einordnen – auch wenn das Ergebnis wenig mit ihm und seiner Kandidatur zu tun hat.
Es dürften unangenehme Fragen auf ihn zukommen. Zum Beispiel, wie er denn zu einer Koalition mit dem BSW in Brandenburg stehen würde. Sollten die Grünen tatsächlich nicht in den Landtag einziehen, wie die Prognosen noch erahnen lassen, könnte es auf ein Regierungsbündnis aus SPD, CDU und BSW hinauslaufen. Zuletzt hatte Merz gesagt, dass er ein Bündnis mit der Wagenknecht-Partei in Thüringen oder Sachsen für "sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich" halte.

Warum Wagenknecht aufpassen muss
Für Sahra Wagenknecht und ihre Partei ist das vorläufige Ergebnis bestenfalls befriedigend. Die 12 Prozent aus der Prognose für das BSW ordnen sich ein zwischen den Resultaten in Sachsen (11,8 Prozent) und Thüringen (15,8 Prozent).
Allerdings ist das BSW in Brandenburg strukturell auch schwächer aufgestellt als in den anderen beiden Ländern, mit weniger Mitgliedern und einer einzigen sichtbaren Führungsfigur. Darüber hinaus war Spitzenkandidat Robert Crumbach im Unterschied zu den Frontfrauen in Sachsen und Thüringen ein Quereinsteiger ohne politische Vorerfahrungen ist.
Nun könnte Brandenburg das dritte Land sein, in dem das BSW zum Regieren gebraucht wird – und in dem Wagenknecht versuchen wird, die Bedingungen zu diktieren. Je mehr ihre Partei in die Verantwortung genötigt wird, umso weniger wird der radikalpopulistische Kurs in Berlin funktionieren. So oder so, Wagenknecht hat ihre Ex-Partei zusätzlich beschädigt: Nachdem die Linke in Thüringen arg gerupft wurde und sich in Sachsen nur per Direktmandaten in den Landtag rettete, ist sie nun im Brandenburger Parlament voraussichtlich gar nicht vertreten.