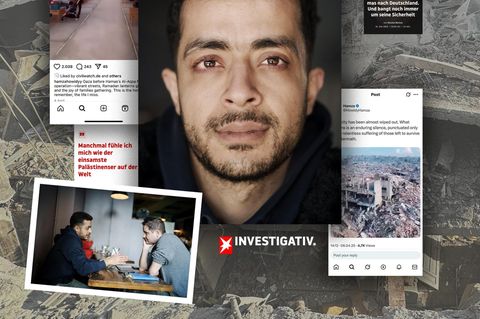Der Name Auschwitz symbolisiert in Israel bis heute die totale jüdische Machtlosigkeit. Die Erinnerung an das Vernichtungslager als Inbegriff des Bösen schwingt seit der Staatsgründung 1948 im öffentlichen Denken und Handeln immer mit. Die starke Bewaffnung und Militarisierung Israels ist auch als Antwort auf die damalige Hilflosigkeit zu sehen. Nie wieder sollen Juden ihren Feinden machtlos und staatenlos ausgeliefert sein und wie "Schafe zur Schlachtbank" geführt werden. Dies ist für jeden israelischen Schüler die zentrale Lehre aus Auschwitz.
"Ich war durch die Hölle gegangen"
Bernhard Dov Lemel war 13 Jahre alt, als er im Juni 1943 mit seiner Familie nach Auschwitz-Birkenau verschleppt wurde. Während seine Eltern und zwei kleinere Geschwister gleich nach der Ankunft in die Gaskammern geschickt wurden, winkte der berüchtigte "Todesengel", SS-Arzt Josef Mengele, den Jugendlichen auf die Seite der für Zwangsarbeiten bestimmten Häftlinge. Nach vier Monaten als "Laufbursche" in Auschwitz, in denen er Zeuge von unbeschreiblichen Grausamkeiten wurde, holte ein Lagerarzt ihn mit elf Kindern zu Hepatitis-Experimenten in das Konzentrationslager Sachsenhausen. Nach dessen Auflösung im April 1945 überlebte Lemel einen zwölftägigen Todesmarsch in Richtung Ostsee.
"Die Befreiung erlebte ich in einem Zustand völliger Erschöpfung in Schwerin", erinnert sich der 75-Jährige, auf dessen Unterarm die in Auschwitz eintätowierte Zahl 125442 noch verschwommen lesbar ist. Er schaffte es zunächst in seine Heimatstadt Bendzin (Bendsburg) - nur wenige Kilometer von Auschwitz entfernt. Gemeinsam mit seinem einzigen überlebenden Bruder, den er dort fand, reiste Lemel dann nach Paris. Nach einer Söldnerausbildung in Marseille meldete er sich 1948 als Freiwilliger im Kampf um die Unabhängigkeit Israels.
"Ich war durch die Hölle gegangen, dennoch war ich aus ganzem Herzen bereit, mich aufzuopfern", meint der Mann, der mit seiner Frau in Jerusalem lebt. Für den Großvater von sieben Enkeln ist "die beste Rache an den Nazis, dass wir trotz allem eine Familie gegründet haben".
Das Grauen ist noch lebendig
Wie für ihn ist das Grauen der Vergangenheit auch für die Holocaust-Überlebenden Seew Schani (77) und Batia Gurfinkel (76) noch ganz lebendig. "Wenn wir uns treffen, kommen wir irgendwann immer auf dieses Thema zurück", sagt Schani, der aus Krakau stammt. Gurfinkel ist letzte Überlebende einer ultra-orthodoxen Großfamilie mit zehn Kindern aus Bendzin. Sie hat fast ihre ganze Familie in Auschwitz verloren und selbst verschiedene Arbeitslager miterlebt. Beide beklagen, sie seien nach ihrer Einwanderung nach Israel mit ihrem Leid bei den "Sabras", den in Palästina geborenen Juden, auf völlige Verständnislosigkeit gestoßen.
Mit den schrecklichen Erinnerungen sind sie sehr unterschiedlich umgegangen. Schani, der die Befreiung in Bergen-Belsen erlebte, hat seinen beiden Kindern früher nie von seinen Erlebnissen im Konzentrationslager erzählt, um sie zu behüten. "Da war eine psychologische Barriere und wir wollten auch nicht, dass sie uns als armselige Opfer sehen." Erst als er Krakau 1995 mit seiner Familie zum ersten Mal wieder besuchte, brach alles aus ihm heraus. "Ich weinte schrecklich und mein Sohn war sehr erschrocken. Im Nachhinein war ich aber zufrieden, weil meine Kinder erst dann wirklich verstanden haben, was ich durchgemacht habe."
Gurfinkel ließ ihre drei Kinder schon "von jüngster Kindheit an" an allem teilhaben, was ihr und ihrer Familie geschehen war, allerdings in entschärfter Form, "eher wie eine Art Abenteuergeschichte". Schweigen sei für sie nicht möglich gewesen. "Was hätte ich denn sagen sollen, als die Fragen kamen, wo ist der Großvater, wo ist die Tante?" Besonders wütend macht es beide, wenn der Holocaust in der israelischen Politik instrumentalisiert wird - wie zuletzt das Tragen orangener "Judensterne" bei Siedlerprotesten gegen eine Räumung des Gazastreifens.