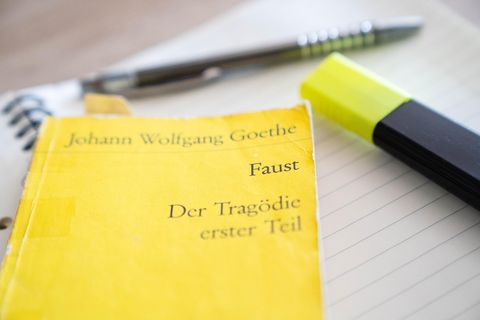Johann Wolfgang von Goethe kommt als Weltmann aus Italien zurück. Er stürzt sich in die Liebe seines Lebens - Christiane, sein Bettschatz. Er stürzt sich in die Lust seines Geistes - die Farbenlehre. Doch der Künstler lässt sich wieder einmal vom Diplomaten überrennen. Er zieht mit seinem Herzog gegen die französischen Revolutionäre, die ihm verhasst sind
Sie läuft über die Wiese, dass die Locken tanzen, rennt, rafft das Sommerkleid mit der Rechten, hält den Brief in der Linken, den Bittbrief vom Bruder. Der ist für Goethe. Sie passt ihn ab im Park, als er aus seinem Gartenhaus kommt. Braungebrannt noch von Italien. Er ist ja erst seit drei Wochen wieder in Weimar. Und sie rennt direkt auf ihn zu: Christiane Vulpius, die herbe Schöne mit den hohen Backenknochen und der Kerbe in den Lippen und den Haaren, die sich wild ums Gesicht ringeln.
Sie knickst und bittet für den Bruder, einen begabten Romanschreiber, der in finanzieller Notlage ist. Sie tut das nicht demütig, nicht kniefällig, sie bittet ernst und plaudert drauflos und lächelt ihn an aus braunen Augen. Ihr Blick schlägt ein bei ihm.
Endlich ein offenes Gesicht! Wie ist er denn empfangen worden im kleinkarierten Weimar? Kalt und steif. Und Frau von Stein war schwer beleidigt. Seine flehentlichen, fußfälligen Bitten, ihm die Rückkehr aus dem römischen Paradies doch zu erleichtern, hatte sie ohne Herz beantwortet. Goethe sei sinnlich geworden, sagt sie angewidert. Und sinnlich heißt bei ihr, die das Asexuelle zum Ideal erhoben, so viel wie aussätzig.
Und nun dieses Mädchen. Ein Naturwesen. Frisch, lachend, leicht erhitzt. Goethe ist bezaubert und beglückt. Sie werden noch am selben Tag miteinander schlafen. Es ist der 12. Juli 1788.
Ein Tag mit Folgen. Denn die 23-Jährige ist ein Mädchen aus dem Volk. Für den Hof unterste Kiste. Proletarierin. Arbeitet in der Fabrik. Näht Seidenblumen. Die Eltern tot. Der Bruder ohne Geld in Nürnberg. Tante und Halbschwester leben von dem, was Christiane verdient. Und nun ist sie die heimliche Geliebte von Goethe. Und der igelt sich oft für Stunden mit ihr im Gartenhaus ein.
Was macht der da bloß?, fragen die Herrschaften vom Hofe. Sie werden es bald in Hexametern lesen können, wie Christiane, wie sie des Tags mich erfreut, wie sie des Nachts mich beglückt.
Aber noch weiß es niemand, Frau Herder tuschelt nur, und Frau von Stein ist äußerst irritiert und misstrauisch. Sie will wieder umworben werden. Natürlich. Sie zitiert Goethe auf ihr Gut nach Kochberg. Freundlich-kühl. Er kommt und kommt das nächste Mal nicht. Die Witterung macht mich ganz unglücklich, schreibt er an sie. Er möchte in seinem Stübchen bleiben, ein Kaminfeuer anmachen, und dann mag es regnen wie es will.Und überhaupt: Wie kann man leben, wenn das Barometer tief steht?
Ausreden. Alles Ausreden. Es geht ihm prächtig. Er liegt warm bei seinem Bettschatz, mit dem er aufzuholen scheint, was er Jahre versäumt. Schlosser Spangenberg jedenfalls schickt eine Rechnung nach der anderen: Bett beschlagen, 6 Paar zerbrochene Bänder dazu mit Nageln... ein Neu gebrochenes Bette beschlagen... Noch ein Neu Bette beschlagen zum Unterschieben. Damit das obere besser hält. Denn: Uns ergötzen die Freuden des echten nacketen Amors/Und des geschaukelten Betts lieblicher knarrender Ton.
Fast neun Monate bleibt die Liaison verborgen. Dann steht plötzlich der junge Fritz von Stein im Gartenhaus. Er sucht Goethe, seinen Ziehvater, und findet Christiane.
Goethe hat eine Geliebte! Der Satz rast durch Weimar. Vulpius? Ja. Die aus der Fabrik? E un bel pezzo di carne, ein herrliches Frauenzimmer. Nein. Ein Blumenmädchen. Wie bitte? Die ist eine allgemeine H. vorher gewesen, sagt Herders Frau entrüstet. Hure, so ein Wort nimmt sie natürlich nur abgekürzt in den Mund.
Er hat also die junge Vulpius zu seinem Klärchen gemacht. Charlotte von Stein ist wie vor den Kopf geschlagen. Sie erinnert sich an ihren Streit mit Goethe um dieses Bürgerkind im 'Egmont'. Degoutant, so eine Figur. Und er hatte ihr vorgeworfen, die Nuance zwischen Dirne und Göttin nicht zu kennen. Nun ist das Wirklichkeit. Sie ist gelähmt, gekränkt, verbittert, eifersüchtig. Sieht auch ihr ganzes Erziehungswerk wanken. Und sieht sich selber lächerlich gemacht vor der Hofgesellschaft.
Und Goethe? Ist verwirrt. Wie sehr ich dich liebe, schreibt er an Charlotte von Stein, wie sehr ich meine Pflicht gegen dich und Fritzen kenne, habe ich durch meine Rückkunft aus Italien bewiesen. Aber sie habe ihn kühl und unfreundlich aufgenommen.
Er schwankt zwischen Wut und Demut. Wird auch scharf: Sie trinke wohl zu viel Kaffee. Das verstärke ihre Hypochondrie. Schon vor zehn Jahren hatte er in 'Wilhelm Meisters theatralischer Sendung' über die verderbliche Bohne geschrieben, die seinen Helden bis an die Pforten des Todes bringt.
Aber dann buhlt er auch wieder. Er braucht sie ja. Auch als Fürsprecherin. Die Hofdame von Stein hat schließlich Einfluss. Und warum nicht zu dritt leben? Die edle Dame für den Geist, den handfesten Küchenschatz fürs Bett.
Er hat sich diesen Wunschtraum doch vor Jahren schon erdichtet: 'Stella' heißt das kleine Drama in fünf Akten. Da nehmen sich am Ende zwei Frauen, die denselben Mann lieben, schwesterlich in die Arme. Die eine hochherzig, die andere sinnlich. Und Fernando selig mittendrin.
Ja, das würde ihm wohl so passen! Verrat. Alles Verrat für Charlotte von Stein. Dieses unzüchtige Verhältnis soll sie tolerieren? Ihren Dichter mit einer Mamsell Vulpius teilen? Niemals!
Wo sind die Zeiten, da Goethe ihr aus Jena süße Trauben in einer Schachtel schickte? Vorbei. Vorbei auch sein Streben nach Vollkommenheit. Goethe ist für sie unters Gewürme gegangen.
Jahrelang werden die beiden kaum ein Wort mehr miteinander wechseln. Wohl Denen, die die Kraft haben, das Leben wegzuwerfen, schreibt sie an einen Freund. Es geht ihr nicht gut. Ihr Mann liegt nach einem Schlaganfall zu Hause. Muss gepflegt werden. Kann nur noch ja und nein sagen. Und Goethe, ihr ganzes Glück, ist verloren.
Aber Goethe ist im Glück. Er bedichtet Christiane, sein klei nes Erotikon, schreibt ihr die 'Römischen Elegien' auf den prallen Leib. Und sie kocht für ihn und trinkt mit ihm Champagner und plappert dabei in breitem Thüringisch, ganz unbefangen, ganz unverbildet, wirbelt bald auch mit unfrisiertem Lockenkopf durchs Haus am Frauenplan, wäscht, putzt, pflanzt und tanzt für ihr Leben gern. Nur lesen mag sie nicht. Liest auch kaum was von Goethe. Nur mal bei üblem Wetter oder aus langer Weile.
Als sie schwanger ist, steht Goethe fest zu ihr. Sonst wäre sie verloren. Unehelicher Beischlaf ist Hurerei. Für eine uneheliche Geburt muss Strafe gezahlt werden. Oberhofprediger Herder, der höchste Geistliche im Land, kassiert drei Reichstaler pro Bankert. Wenn er nicht da ist, steckt seine Frau die Gelder in die Haushaltskasse.
Goethe regelt das also mit der Schwangerschaft. Also keine peinlichen Fragen, keine Schwurhand - wer war der Vater? Schwören Sie! - Aber Goethe hält sich nicht an die Spielregeln der Oberschicht. Verhältnisse, Mätressen, Liebschaften? Alles erlaubt. Aber bitte diskret. Und was tut Goethe? Lebt vor aller Augen in wilder Ehe. Und das im feinen Haus am Frauenplan, einen Sprung vom Hof des Herzogs entfernt. Das geht nicht.
Goethe muss umziehen. Muss mit der hochschwangeren Christiane, deren Schwester und Tante raus vor die Tore Weimars. Ins Jägerhaus. Zu Hühnern, Frettchen und Fasanen. Die Köchin muss er entlassen, den Diener auch. Kein Platz mehr. Welch eine Schmach für Goethe. Welch eine Demütigung. Und als am 25. Dezember 1789 dem 40-jährigen Kindernarr der Sohn August geboren wird, beginnen Klatsch und Tratsch von vorne. Seht die Hure mit dem Bankert! Armer Goethe!
Das ist die Zeit, in der Goethe seinen 'Tasso' zu Ende schreibt. Tasso ist Bein von meinem Bein, sagt er, und Fleisch von meinem Fleisch. Tasso, der Hofpoet, der für einen kleinen Kreis dichtet, Goethe, der Dichter bei Hofe, lässt Tasso wahnsinnig werden und rettet so sich selbst vorm Absturz. Wie damals beim Werther, dem Goethe auch das eigene Elend in die Schuhe schob. Werther musste sich erschießen, damit Goethe leben konnte. Und er hört es gern, dass ein Kritiker schreibt: Tasso ist der gesteigerte Werther. Tasso ist vor allem das Genie. Und Genie kann man nicht heilen, nicht retten. Genie ist ein Zustand. Genie kann mehr als alle. Tasso erklärt es am Ende: Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, / Gab mir ein Gott, zu sagen, wie ich leide.
Aber auch der Genius braucht manchmal den Zufall. Goethe hat sich bei einem Professor aus Jena Prismen ausgeliehen. Er will damit Versuche machen, vergisst die Dinger dann aber. Bis der Professor mahnt und seinen Diener schickt.
Goethe kramt die geschliffenen Gläser hervor, will sie aushändigen, nimmt eins und hält es so zum Spaß gegen seine frisch geweißte Wand. Er will das Farbspiel sehen, das man mit Licht durchs Prisma erkennen kann. So hat es der englische Wissenschaftler Newton jedenfalls vor hundert Jahren gesagt.
Aber was sieht Goethe? Nur weiß. Keine Farben. Ein Blitz schlägt ein bei ihm, ein coup de foudre. Newton ist ein Betrüger. Seine Theorie ist falsch. Licht kann eben nicht zerteilt werden. Licht ist eins.
Nein, er rückt die Prismen nun nicht mehr raus. Murmelt ein paar Entschuldigungen und schickt den Boten wieder weg. Und dann beginnt der Kampf. Sein Kampf gegen Newton. Ein Physiker will Goethe vorsichtig beibringen, dass Newton nie behauptet habe, der Blick durchs Prisma auf eine weiße Wand wäre bunt. Newton habe Lichtstrahlen durch ein enges Loch gelenkt ...
Durch ein Loch? Die Natur also gezwungen? Das Licht auf die Marterbank gelegt? So nach Folterweise: Gestehe! Oder das Loch wird enger! Das ist ja noch schlimmer! Und es gibt kein richtiges Weiß? Weiß sei nur die Summe sämtlicher Spektralfarben? So was kann man ihm nicht weismachen. Er will der Ritter sein, sagt er, der die Farbprinzessin befreit.
In Paris Sturm auf die Bastille, in Weimar bei Goethe - Funkstille. Er schreibt kein Wort über den Ausbruch der Französischen Revolution. Er trennt das Licht von der Finsternis. Und findet dazwischen das Trübe. Er konstruiert ein Holzgestell für sein großes Gartenprisma aus Glasscheiben. Er macht Experimente, zeichnet, schneidet Pappe aus, klebt Muster, malt, zeichnet und publiziert alles schleunigst.
Er schreibt ins Vorwort zur Farbenlehre: Die Newtonische Theorie sei eine alte Burg, und die werde er nicht belagern, sondern von Giebel und Dach herab abtragen, damit die Sonne doch endlich einmal in das alte Ratten- und Eulennest hineinscheine. Ja, er hasst Newton.
So schreibt er unverdrossen. Schreibt mit Schwung über Schwarz und Weiß, blendend Farbloses, farbige Schatten, pathologische Farben. Und ernennt Blau und Gelb - Werthers Farben - zu den Hauptfarben, die einen reinen Begriff geben.
Und dann Caspar David Friedrich: Also schöne Baumarten hat er ja gemalt, aber von der Kunst der Beleuchtung - keine Ahnung. Und weg mit den gläsernen Hilfsmitteln von Newton. Das Auge allein ist für ihn der vollkommenste Apparat. Also auch weg mit den Brillen. Leute, die Brillen tragen, haben bei Goethe keine Chance. Also Brille ab, oder sie werden nicht vorgelassen. Er selbst benutzt ein Lorgnon. Aber Goethe ist ja auch Goethe.
Gott Goethe also trennt das Licht von der Finsternis, während Schiller, Klopstock, Herder, Humboldt, Hegel und Hölderlin die Französische Revolution begrüßen. Sie singen Hymnen auf die Freiheit. Und Menschenwürde ist das Wort der Zeit.
Das ist dem konservativen Goethe alles ziemlich fremd. Sein Dunstkreis ist das Höfische. Er ist für aufgeklärten Despo tismus. Aber die wenigsten deutschen Potentaten sind aufgeklärt. Die meisten haben Grund z ur Panik. Haben das Volk über Jahrzehnte ausgenommen, Steuern erpresst und Haremwirtschaft betrieben. August der Starke von Sachsen hat 364 Bastarde gezeugt. Und Geliebte kosten Geld. Da werden eben Soldaten verkauft und auch Lebenslängliche aus Gefängnissen verschachert. Schiller hat das in 'Kabale und Liebe' beschrieben: Der Fürst lässt seiner Mätresse Diamanten reichen. Nein, die kosten nichts, denn gestern sind 7000 Landeskinder nach Amerika fort - die zahlen alles.
Auch Goethe hat solche Listen mit abgezeichnet. Er hat auch eine Akte über Schiller anfertigen lassen. So ein kritischer Kopf muss schließlich beobachtet werden. Goethe hat nichts übrig für politische Ideale. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Parolen. Auch Tyrannei ist nur ein Wort.
Das Volk ist ihm gleichgültig. Seine Dramen spielen dort, wo der Geist weht und die Luft dünn wird. Respekt hat er schon vor einfachen Menschen. Er liebt ja auch ein Kind aus dem Volk. Aber die Menge verachtet er. 'An die Menge', schreibt er in den Xenien: Was für ein Dünkel! Du wagst, was wir alle loben zu schelten? / Ja, weil ihr alle, vereint, auch noch kein Einziger seid.
Und in Frankreich bewaffnet sich nun das Volk, dringt ins Schloss, arretiert den König und lässt ihn köpfen. Und der Pöbel singt: Ca ira, L'aristocrat a la laterne! Nein, die Trikolore passt nicht in Goethes Farbenlehre. Mirabeau, Danton, Robespierre - sie alle sind ihm nicht geheuer.
Und dann schwappt die Revolution nach Deutschland. Überpflanzung neufranzösischer Grundsätze auf deutschem Boden muss verhindert werden, sagt Herzog Carl August. Und zieht im Juni 1792 als Befehlshaber eines preußischen Regiments in Richtung Paris. Goethe will mitkommen. Aus wahrer persönlicher Anhänglichkeit an meine Person, meint der Herzog.
Aber Goethe tut es vor allem wohl aus wahrem persönlichen Kalkül. Denn eigentlich verlässt er sein häusliches Glück mit Weib und Windelkind sehr ungern. Der kleine August ist noch nicht mal drei. Doch sein Instinkt sagt ihm, es wäre klug.
Es ist klug. Denn Carl August dankt Goethe noch vor der Abfahrt in den Krieg mit einem fürstlichen Geschenk: dem Haus am Frauenplan. Wert etwa 6000 Taler. Er darf also nach gut drei Jahren Verbannung vor die Tore Weimars zurück in die Umgebung der Seligen.
Also Goethe kommt nach. Zuvor muss er im Auftrag seines Herrn die Studentenrevolte in Jena deckeln. Er tut das mit Schärfe. Verbietet alle akademischen Orden. Er verweist dabei auf französische Gesetzlosigkeit.
Dann packt er seine Koffer für den Krieg. Packt Rock und Weste ein, Physikbücher und Manuskripte der Farbenlehre. Am 8. August bricht er auf. In Zivil. In seiner böhmischen Halbchaise. Begleitet von Diener Götze und Sekretär Vogel.
Die Reaktion reist der Revolution entgegen. Ein Spaziergang, hatte Carl August gesagt. Wir werden Champagner trinken, ohne einen Schuß zu tun. Am 27. August erreicht Goethe das Feldlager und zieht in seiner Equipage neben der Armee her bis ins eroberte Verdun.
Von hier aus schickt er Christiane verzuckerte Gewürzkörner, die berühmten Verdun-Dragees. Und bei Regen reitet er los und macht Experimente mit Tonscherben in Wassertümpeln, erledigt auch die Dienstpost für den Herzog und schreibt Briefe an sein Erotikon: Ach, mein Liebchen! es ist nichts besser als beisammen zu sein ... Schreibt auch, dass er eifersüchtig ist. Stellt sich vor, dass andere ihr besser gefallen könnten, weil ich viele Männer hübscher und angenehmer finde als mich selbst.
Er freut sich, dass sie in seiner Abwesenheit das Haus am Frauenplan auf Vordermann bringt. Mache nur, daß unser Häuschen recht ordentlich wird, schreibt er. Und klagt: Wir sind so nah an Champagne und finden kein gut Glas Wein. Er weiß, das wird am Frauenplan anders, wenn nur erst mein Liebchen Küche und Keller besorgt. Schon vor mehr als zwanzig Jahren hat er doch ins Tagebuch geschrieben: Ohne Wein und ohne Weiber / Hol der Teufel unsre Leiber!
Abends unterhält Feldpoet Goethe dann schon mal die feineren Militärs, Aristokraten alle, erheitert und erquickt sie mit kurzen Sprüchen. Er darf mit im herzoglichen Schlafwagen logieren. Wenn es regnet und der Boden aufgeweicht ist, lässt er sich von Soldaten hinein- und hinaustragen.
Nein, es wird kein Spaziergang. Am 19. September stoppt ein vorzüglich geordnetes Sansculotten-Heer die preußische Armee. Der Krieg geht nicht nach Wunsch, schreibt Goethe an Minister Voigt, den ersten Mann in Weimar. Am 20. September beginnt die Kanonade von Valmy. Zehn Tage Gedonner. Zehn Tage Regen. Pulverwagen fliegen in die Luft. Zwei Heere messen ihre Maschinen. Die Preußen liegen im Dreck. Die Franzosen verlieren nur 150 Mann, die Preußen nur 184. Und doch ist die Kanonade die Entscheidungsschlac ht. Denn die Preußen ziehen ab. Ohne angegriffen zu haben. Keine Chance.
Und Goethe? Reitet in jenen merkwürdigen Kriegstagen im braunen Zivilmantel allein aufs Schlachtfeld raus. Er will das Kanonenfieber beobachten, die imposanten Lichteffekte sehen. Kann er doch alles für die Farbenlehre gebrauchen. Die Kanonenkugeln klatschen dumpf in den Matsch. Und es regnet und regnet und regnet. Und so kommt am 30. September der Befehl zum Rückzug.
Goethes vier Pferde können die Halbchaise nicht durch den aufgeweichten Boden ziehen. Er fährt im sechsspännigen Küchenwagen des Herzogs weiter. Liest dort in seinem physikalischen Lexikon. Sieht rechts und links vom Weg Pferdekadaver, faulende Leichen und krepierende Soldaten. 19000 Mann werden an Typhus und Ruhr verrecken. Das halbe Heer.
Wir werden daheim den Damen noch etwas zu erzählen haben, sagt Goethe. Ein paar Offiziere drängen den Dichter, die Schlacht doch zu beschreiben. Und dass der Regen schuld war am Schlamassel.
Nichts wird Goethe tun. Ein Husarenoberst sagt das sehr deutlich: Er ist viel zu klug! Was er schreiben dürfte, mag er nicht schreiben, und was er schreiben möchte, wird er nicht schreiben. So ist es. Goethe vernichtet sogar noch auf der Heimreise sein Kriegstagebuch in einem lebhaften Steinkohlenfeuer.
Nein, Geschichte ist seine Sache nicht. Geschichte ist für ihn ein Mischmasch von Irrtum und Gewalt. Erst aus der Distanz, genau dreißig Jahre später, wird Goethe seine 'Kampagne in Frankreich' schreiben. Und da steht dann auch jener Satz, den er im Angesicht der Kanonade von Valmy gesagt haben will: Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabeigewesen.
Im Augenblick aber freut er sich, dass er da rauskommt aus diesem bösen Traum. Und wie er aussieht! Unrasiert seit Wochen. Und das Haar verfilzt. Am 21. Oktober notiert sein Diener im Ausgabenbuch: Friseur. Und an Freund Herder schreibt Goethe, er sei gefangen gewesen zwischen Kot und Not, Mangel und Sorge, Gefahr und Qual, zwischen Trümmern, Leichen ... und Scheishaufen.
Auf Umwegen trifft er kurz vor Weihnachten in Weimar ein. Nun wieder am Frauenplan. Christiane, das Liebchen, hat die Umbauten beaufsichtigt, die große Treppe mit den flachen Stufen, auf denen es sich so herrschaftlich hochsteigen läßt, den Kamin, den Umzug, den Einzug mit Tante, Schwester, Dienern. Alles wie früher. Und was sie inzwischen alles kochen kann! Hahn in Austernsauce, Krebse mit Anis und Dill, Froschkeulen, Fasane und Gänse mit Kastanien.
Goethe wird ein kleines Lehrgedicht für seinen Schatz machen: Immer ist so das Mädchen beschäftigt und reifet im stillen / Häuslicher Tugend entgegen, den klugen Mann zu beglücken. / Wünscht sie denn endlich zu lesen, so wählt sie gewißlich ein Kochbuch.
Er selbst wählt Plato. Um die erbärmlichen Bilder des Krieges aus dem Kopf zu kriegen. Sokrates, liest er dort, habe oft von seinem Daimon geredet, der ihn seit seiner Kindheit beriet. Zum Beispiel auch: keine Staatsgeschäfte zu betreiben.
Aber Goethes Wirklichkeit sieht anders aus. Schon ein halbes Jahr später stehen die Welthändel wieder auf dem Programm. Er begleitet seinen Herzog zur Belagerung nach Mainz.
Kanonenschüsse haben die Entstehung der ersten deutschen Republik verkündet. Franzosen rudern über den Rhein zu den Mainzer Jakobinern. Man nimmt sich gegenseitig fest und befreit sich wieder. Mainz singt und lacht und trinkt Champagner mit den Revolutionären. Das muss ein Ende haben. Also wird die Stadt belagert. Goethe und sein Herzog sind dabei.
Auf dem Weg ins Krisengebiet besucht Goethe seine Mutter in Frankfurt, der Vater ist seit gut zehn Jahren tot. Erst jetzt erzählt Goethe ihr, dass er seit Jahren eine Ehe ohne Zeremonie führt und einen Sohn hat, August, dreieinhalb. Das muss die Mutter erst einmal schlucken.
Später wird sie ihm schreiben: Da unter diesem Mond nichts Vollkommenes anzutrefen ist, tröste sie sich damit, dass ihr Hätschelhans vergnügt und glücklicher als in einer fatalen Ehe ist - küsse mir deinen Bettschatz und den kleinen Augst.
Nun gehen auch Briefe und Geschenke hin und her. Und Goethe bestellt bei seiner Mutter eine Spielzeug-Guillotine für seinen Sohn. Lieber Sohn! schreibt Frau Rath Goethe da, eine solche infame Mordmaschine zu kaufen - das thue ich um keinen preiß.
Die Belagerung von Mainz dauert. Christiane ist wieder schwanger, August hat die Blattern, Goethe plagen im Hauptquartier die Wanzen, aber sonst, schreibt er nach Hause, fehlt es an nichts und es ist viel lustiger als vor dem Jahre.
Er kann auch arbeiten. Hat seine Farbenlehre natürlich wieder dabei, vergleicht seine Thesen mit Schriften von Jean Paul Marat. Der hat auch übers Licht geschrieben. Jetzt ist er der schärfste Revolutionär von Paris und wird am 13. Juli von Charlotte Corday in der Badewanne erstochen.
Goethe stürmt weiter seine eigene Bastille, die Newton heißt. Dazwischen schreibt er 'Reineke Fuchs' in Hexametern. Die Geschichte ist ein Spiegel der Zeit: Danton, Desmoulins, Saint-Just, Robespierre, die Aristokraten, der König, das Volk. Kommt doch alles auch in dieser alten Tierfabel vor. Sie intrigieren und denunzieren, und der Löwe ist der König und viel zu gütig, und die Hasen sind ganz arme Schweine und die Hennen auch. Einfach zu blöde, den Fuchs zu durchschauen und plärren dann, wenn der ihre Kinder frisst. Gefragt ist der Kopf, die Schlauheit von Meister Reineke. Der triumphiert. Und alle Morde sind vergessen.
Liebesbriefe gehen hin und her zwischen Goethe und Christiane. Du Süßer, schreibt sie, August redet immer von Dir und lernt fleißig sein abc. Aber ihre Gurken im Garten seien eingegangen. Tröste dich ja über deine Gurken, antwortet Goethe und erzählt, wie Mainz nach und nach vor unseren Augen verbrennt.
Es ist das große Bombardement. Gegen Trinkgeld lassen die Wachen Neugierige zur vordersten Linie durch. Aber bücken!, rufen die Ordner. Wenn das Mündungsfeuer blitzt - bücken! Nach drei Wochen kapituliert die Festung.
SALVE. Goethe ist wieder in Weimar. In seinem Haus am Frauenplan. Im Boden vor dem Empfangssaal ist die römische Begrüßung eingelassen: Salve. Das Haus sieht prächtig aus. Steht im Saft der Antike. Statuen überall. Der gewaltige Kopf der Juno überragt alles.
Und Goethe empfängt. Hält Hof. Gibt Soireen, Soupers, Dejeuners. Die Creme des Stadtadels kommt, und die Creme des Geistes klingelt an, Hölderlin, Hegel, Kleist, Jean Paul, Schelling, auch Herder und Wieland natürlich, die Freunde. Und Bertuch kommt, der reichste Fabrikant von Weimar, bei dem Christiane in der Fabrik Seidenblumen genäht und dem Goethe und sein Herzog einst mit Peitschen das Mobiliar zerschlagen.
Und Christiane? Sie kocht und brät und backt und schmückt die Tafel für die feine Herrschaft. Wenn die Gäste kommen, verschwindet sie. In die Küche oder in ihr Zimmer. Sie ist noch immer der Makel an Goethe.
Sie nimmt das hin. Klagt nicht. Klagt nur, wenn ihre Kinder sterben. Und es sterben vier. Kommen gesund zur Welt und sind ein paar Tage später tot. Steckfluß, heißt es im Weimarer Totenbuch.
Zu jener Zeit, als Goethe seine Gesellschaften gibt, ist auch Karl August Böttiger, Direktor des Weimarer Gymnasiums, Gast am Frauenplan. Welch himmlisches Idyll beschreibt er in der wohlgeheizten Stube: Dahin der Apoll aus Italien. Dick sei Goethe geworden. Seine Augen sitzen im Fett der Backen, und die Haare gehen ihm aus. Sitzt da im Lehnstuhl, eine weiße Mütze auf dem Kopf, das Moltumjäckchen über Flauschhosen, die Pantoffeln runtergetreten, die Strümpfe ziehen Wasser, Klein-August schaukelt auf seinen Knien, und zu seiner Rechten sitzt Donna Vulpia mit dem Strickstrumpf.