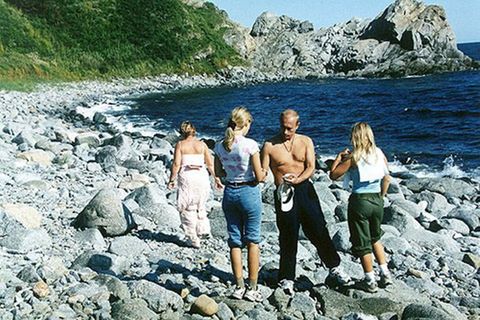Als die halb verhungerten und traumatisierten Überlebenden der 900 Tage dauernden deutschen Belagerung Leningrads vor 60 Jahren das Schlimmste überstanden hatten, ging die Qual für Vera Ljudyno weiter. Denn sie wurde nach dem Ende der Belagerung zu sechs Jahren Zwangsarbeit in einem sowjetischen Lager verurteilt. Ihr Verbrechen? Sie hatte ein Tagebuch geführt, in dem sie nicht nur den heldenhaften Kampf der Bewohner ums Überleben beschrieb, sondern auch das Unvermögen der Sowjetbehörden, die Bürger zu schützen.
Und nicht zuletzt beschrieb sie, welche Grausamkeiten die blanke Not bei verzweifelten Eingeschlossenen auslöste. "In diesem Tagebuch habe ich über das geschrieben, was ich gesehen habe: schrecklichen Hunger, die Zahl der Bombardierungen, die steif gefrorenen Leichen, die einfach an Gebäuden lehnten, und die Lastwagen mit Toten, die durch die Stadt fuhren", erzählt Ljudyno.
Fast drei Jahre lang eingekesselt
St. Petersburg, das frühere Leningrad, feierte am Dienstag den 60. Jahrestag der Befreiung von deutschen Truppen. Am 27. Januar 1944 befreite die Rote Armee die während des Zweiten Weltkriegs fast drei Jahre eingekesselte Stadt. Hunger und Bombenangriffe während der Belagerung hatten rund 600.000 Menschen das Leben gekostet. Lange Zeit standen stolze Berichte über gegenseitige Hilfsbereitschaft und den alles dominierenden Überlebenswillen der Bewohner im Mittelpunkt des öffentlichen Rückblicks. Doch in jüngster Zeit kommen verstärkt auch Erinnerungen wie die Ljudynos ans Licht, die die Schattenseiten nicht außer Acht lassen.
Ljudyno war 17 Jahre alt, als die Truppen Hitlers die Stadt im September 1941 einkesselten. Sie schnitten Leningrad vom Rest des Landes ab und bombardierten das wichtigste Nahrungsmitteldepot, Badajewski. Die Tagesration für die Menschen bestand aus 125 bis 250 Gramm Brot - eine dunkle Mischung aus Mehl und Sägespänen. In ihrer Verzweiflung kochten die Bewohner Suppe aus Leim, Ledergürteln oder Kartoffelschalen. Sie tranken Tee aus Kiefernzweigen und hoben Erde in der Nähe des Badajewski-Depots aus: Dort war bei den Bombardements gelagerter Zucker in den Boden geschmolzen. Die sowjetische Propaganda zensierte die schlimmsten Berichte aus Leningrad, Fotos mit mehr als drei Toten durften nicht veröffentlicht werden.
Den größten Teil der Belagerung verbrachte Ljudyno in einem Gipskorsett. Denn kurz vor dem Krieg war sie wegen einer angeborenen Gelenkdeformation an den Beinen operiert worden. Daher konnte sie nichts tun, außer aus dem Fenster zu schauen und in ihrem Tagebuch zu beschreiben, was sie sah. "Es war eine Zeit, die in den Menschen das Beste und das Schlimmste hervorbrachte", sagt sie. "Die meisten folgten nur noch einem einzigen Instinkt: zu essen." Einer ihrer Nachbarn, ein Sänger, aß seine gesamte monatliche Fleischration von 200 Gramm auf einmal auf, damit sie ihm niemand stehlen konnte. Eine andere Nachbarin trug eine kleine Tasche um den Hals, in der sie ihre Brotration aufbewahrte. Denn sie befürchtete, dass ihre Tochter oder ihre Enkel das Brot sonst essen könnten. "Diese Frau ist später gestorben, mit der Tasche um den Hals."
Plünderungen und Kannibalismus
Es gab Plünderungen und Kannibalismus. Kinder aus einer Großfamilie in Ljudynos Wohnhaus verschwanden, und ihre Kleidung und Knochen wurden später in der Wohnung eines Geigers in der Nachbarschaft gefunden. Der fünfjährige Sohn des Geigers verschwand ebenfalls. In der schlimmsten Zeit habe ihre Familie Gelatine aus Ledergürteln gekocht, oder aus Leim, gewürzt mit Lorbeerblättern. "Wenn man das gegessen hat, hat der ganze Magen gebrannt, und man hat viel Durst bekommen. Der Trick war, dass man trotzdem nichts getrunken hat, um das Sättigungsgefühl zu behalten."
Ljudynos Mutter verlor ihre Bezugskarte für Lebensmittel, als sie jenseits der Stadtgrenze beim Bau von Verteidigungsanlagen half. Staatliche Arbeiter nahmen sie ihr ab. "Meine Mutter hat mir erzählt, dass dort viele Leute vor Hunger starben, weil sie fast nichts zu essen hatten." Doch sollte das vertuscht werden: "Die Leichen der Verhungerten wurden so auf Wagen geladen, dass es aussah, als säßen sie dort, und dann wurden sie irgendwohin gefahren."
Weil sie in Gips lag, konnte sie während der Bombenangriffe nicht in den Luftschutzkeller flüchten. Ihr Vater blieb mit ihr in der Wohnung, und die beiden spielten zur Ablenkung Schach. Der Vater verhungerte 1942. Im Frühjahr 1943 bekam Ljudyno den Gips abgenommen. Wenige Monate später nahm sie ein Klavierstudium am Konservatorium auf. Und sie begann, Freunden aus ihrem Blockadetagebuch vorzulesen. Kurz nach dem Ende der Belagerung wurde sie im Februar 1944 festgenommen und wegen antisowjetischer Propaganda zu sechs Jahren Lagerarbeit in Kasachstan verurteilt.
Verzweifelte Lage sollte vertuscht werden
Das Tagebuch verschwand einige Tage vor ihrer Festnahme. Psychologisch gesehen sei die Lagererfahrung für sie viel härter als die Zeit der Belagerung gewesen, sagt sie. "Zu sehen, wie Geheimdienstpolizisten jemanden zu Tode treten ist etwas völlig anderes, als Menschen verhungern zu sehen."