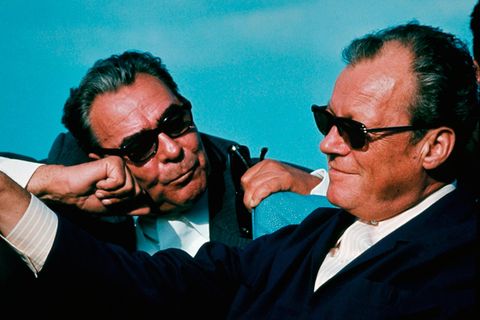Der Abend auf Helgoland war sehr feucht, aber nicht wirklich fröhlich. Willy Brandt schüttete Rotwein in sich hinein, sang mit den Genossen "Oh du schöner Westerwald" und machte das, was er oft tat, wenn er Umsitzende auf Distanz halten wollte: Er erzählte Witze.
Gedanklich war der Kanzler weit weg: bei Günter Guillaume, seinem Referenten, der ein paar Tage zuvor als DDR-Agent verhaftet worden war. Und, vor allem, bei einem Brief des Bundeskriminalamts. Danach soll Guillaume ihm auf Reisen rund um den Globus zahlreiche Damen "zugeführt" haben; die Ermittler verfolgten sogar den Verdacht, die "Frauendienste" seien aus der Staatskasse entlohnt worden.
Ekel und Empörung
Hanebüchen! Allmählich steigerte sich Brandt in eine gefährliche Mischung aus Ekel und Empörung. Reichte es nicht, dass er die Folgen der Ölkrise, rebellische Jusos und Herbert Wehner am Hals hatte? Jetzt war auch noch seine Intimsphäre ausspioniert worden, und wieder drohte, was er, der bankerte Exilant, der "Vaterlandsverräter Frahm", zu oft hatte erleben müssen: eine Diffamierungskampagne. Mitten im Trubel, erinnert sich Ohrenzeugin Wibke Bruhns, murmelte Brandt plötzlich: "Scheißleben."
Offenkundig war er sogar so weit, dem ein Ende zu setzen. Brandt-Experte Gregor Schöllgen jedenfalls kommt nach umfangreichen Recherchen zu dem Ergebnis: Der Kanzler hatte an diesem 1. Mai 1974 ernsthaft an einen Freitod gedacht. In seiner Biografie schreibt er: Brandt ist zeitlebens ein einsamer Mann; wenn sich langjährige Weggefährten in einer Beobachtung einig sind, dann in dieser. Niemand ist da, dem er sich anvertrauen, dem er sagen könnte, dass er daran denkt, mit allem Schluss zu machen.
Einige in seiner Umgebung spüren, dass er "düsteren Gedanken" nachhängt, wie er selbst notiert. Willy Brandt hat damals, am 1. oder 2. Mai, auch einen Abschiedsbrief an die Familie zu Papier gebracht, ihn dann aber doch wieder zerrissen.
Brandt fängt sich wieder, tritt aber fünf Tage später als Bundeskanzler zurück. Er wolle in der Politik bleiben, teilt er in einem bisher unbekannten Brief Bundespräsident Gustav Heinemann mit, "aber die jetzige Last muss ich loswerden".
Der faszinierendste Politiker der Nachkriegszeit
Dies ist die Geschichte des faszinierendsten deutschen Politikers der Nachkriegszeit - wegen seiner politischen Positionen, seiner ungeklärten Herkunft, seiner Zeit im Exil, seines unorthodoxen Lebenswandels und insbesondere wegen seines Verhältnisses zu Frauen. Der gegen Nazideutschland gekämpft hat, seinen nom de guerre beibehielt und - ein Bild für die Ewigkeit - vor dem Mahnmal im Warschauer Ghetto auf die Knie gefallen ist. Architekt der Ostpolitik und Großvater der Einheit.
Brandt war ein Melancholiker und notorischer Morgenmuffel voller Widersprüche. Ein Arbeiterkind, das früh den Habitus des Aufsteigers pflegte. Er wollte mehr Demokratie wagen und verteidigte Berufsverbote. Politisch "bis zum Letzten ehrlich", wie ihn sein Koalitionspartner Walter Scheel (FDP) rühmt, privat ein konfliktscheuer Schluri, der nicht treu sein konnte.
Geliebt und geschmäht. Hart im Nehmen und zugleich hoch empfindlich. Er wusste, wie Recht Scheel mit seiner Einschätzung hatte, "dass nur eine außergewöhnliche Häufung von Zufällen einen Mann Ihrer Struktur an die Spitze einer Regierung bringen konnte".
Das fängt mit den kuddelmuddeligen Familienverhältnissen an. Es sei nicht einfach, "in dieser Gesellschaft als Kind aus dem Chaos zu bestehen", hat Brandt nach seiner Wahlniederlage 1965 im SPD-Vorstand bitter zu Protokoll gegeben. Unehelich geboren am 18. Dezember 1913, als Herbert Ernst Karl Frahm ins Lübecker Geburtsregister eingetragen, den Vater nie gesehen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg fragt er seine Mutter schriftlich, wer sein leiblicher Vater war, und erhält "prompt einen Zettel" (Brandt) zurück. Darauf steht: John Möller aus Hamburg.
Ein "richtiger Junge"
Da Martha Frahm eine schwere Sechstagewoche hat, gibt sie den kleinen Willy bei ihrer Nachbarin Paula Bartels-Heine in Obhut. Sie verwahrt das Kind von Sonntagabend bis zum folgenden Samstag. Jahrzehnte später beschreibt sie ihn als einen "richtigen Jungen, der sich nicht die Butter vom Brot nehmen ließ und durchaus seinen eigenen Kopf hatte". Noch im hohen Alter stellt Willy Brandt fest, dass es für ihn nicht jene "normale Bindung geben konnte", die jemand empfindet und entwickelt, "wenn er bei der Mutter aufwächst".
Als Sechsjähriger kommt Brandt dann zu seinem aus dem Krieg zurückgekehrten Opa Ludwig Frahm, der den Ziehsohn zur sozialistischen Arbeiterbewegung führt. Dass er nicht der leibliche Vater seiner Mutter ist, also auch gar nicht sein Großvater - auch das erfährt Brandt erst als Erwachsener.
Es überrascht nicht, dass Ludwig Frahm von Willy Brandt "Papa" genannt wird und noch in dessen Reifezeugnis als Vater firmiert. 1919 heiratet er zum zweiten Mal, die zehn Jahre jüngere Dorothea Sahlmann. Willy Brandt kann sie "nicht ausstehen", muss aber fortan Ludwig Frahm mit dieser Person teilen. Folglich nennt er Dorothea Frahm auch nicht "Oma", schon gar nicht "Mama", denn eine solche hat er ja, sondern "Tante". Als "Onkel" firmiert übrigens der Mann seiner Mutter, der mecklenburgische Maurerpolier Emil Kuhlmann, den Martha Frahm heiratet, als der Junge 13 Jahre alt ist.
Eher rhetorisch fragt Schöllgen: Kann es angesichts dieser frühen, prägenden Erfahrung überraschen, dass sich Brandt seinerseits mit der Vaterrolle und dem Familienleben schwer getan hat?
Vier Dauerbeziehungen
Vier Dauerbeziehungen ist Brandt in seinem Leben eingegangen, die erste noch vor seiner Flucht vor den Nazis ins Exil: Im Sommer 1933 folgt ihm seine 19-jährige Freundin Gertrud Meyer, genannt "Trudel", nach Oslo. Die beiden ziehen zusammen und gelten, obwohl nicht verheiratet, als Ehepaar. Tatsächlich geht Gertrud im Februar 1936 eine Scheinehe mit dem norwegischen Studenten Gunnar Gaasland ein, um in den Besitz der norwegischen Staatsbürgerschaft zu kommen und so vergleichsweise unbehelligt Kurierdienste nach Deutschland durchführen zu können. Auch Brandt reist als Gunnar Gaasland 1936 erst nach Berlin und später nach Spanien.
1939 zieht Gertrud nach New York. Nach eigenem Bekunden tut sie diesen Schritt, um den Psychoanalytiker Wilhelm Reich zu begleiten, dessen Sekretärin und Mitarbeiterin sie ist. Vermutlich ist sie durch die Erkenntnis, Brandt nicht dauerhaft an sich binden zu können, in ihrem Entschluss bestärkt worden. Zum ersten Mal im Leben des Willy Brandt geht damit die langjährige Beziehung zu einer Frau in die Brüche.
Reich verdankt Brandt die Erkenntnis: "Sexuelle Verklemmtheit scheint für begabte Hasser und Intriganten zu sorgen: Politik als Ersatzliebe tarnt sich nicht selten als selbstlose Unbedingtheit."
Von Gertrud verlassen, trifft Brandt die Norwegerin Anna Carlota Thorkildsen wieder, die er schon früher in Oslo kennen gelernt hat. Beinahe zehn Jahre älter als er, in Köln geborene Tochter eines Norwegers und einer Deutsch-Amerikanerin. Bald wird er erstmals Vater: Am 30. Oktober 1940 kommt Tochter Ninja zur Welt. Im Mai 1941 heiratet er Carlota. Bereits im Januar 1943 zieht sie aus der gemeinsamen Wohnung aus, und im folgenden Jahr zerbricht die Ehe endgültig, wenn sich Carlota vorerst auch weigert, in die Scheidung einzuwilligen.
Begegnung mit Rut Hansen
Inzwischen hat Brandt Rut Hansen kennen gelernt, sieben Jahre jünger als er und verheiratet mit dem Widerstandskämpfer Ole Olstad Bergaust, der 1946 nach langer Krankheit stirbt. Ihre Beziehung wird über 30 Jahre lang halten, trotz zahlreicher Affären, die sich Willy leistet - der seiner Gattin schon früh "für eheliche Verhältnisse nicht geschaffen" scheint.
Ab 1949 sitzt er für die SPD im Bundestag, und am Rhein beginnt für Willy Brandt die erste einer Reihe amouröser Geschichten, die ihm im Verlauf seiner Karriere sehr zu schaffen machen wird. Die Geliebte heißt Susanne Sievers, war Sekretärin im Parlament, ist geschieden und hat zwei Kinder. Wann immer Brandt in Bonn ist, trifft er sie; ansonsten korrespondieren Susanne und der "Bär", wie er sich selbst in seinen Briefen nennt. Im Juni 1952 wird Susanne Sievers in der DDR wegen Agententätigkeit verurteilt und muss eine vierjährige Zuchthausstrafe absitzen. Als sie sich danach Hilfe suchend an Willy Brandt wendet, muss sie erfahren, dass diesem die Verbindung mittlerweile höchst unangenehm ist. Die tief Enttäuschte rächt sich und macht ihre Informationen, darunter Brandts Briefe, dem Journalisten Hans Frederik zugänglich, der das Material 1961 publiziert.
Rut Brandt leidet - stumm. Aus Tagebuchnotizen rekonstruiert sie später, dass sie "niemals in meinem Leben so unglücklich war". Konsequenzen zieht sie keine - jetzt sowenig wie nach der Guillaume-Affäre, als Willy ihr erst gesteht, "dass er ein ernstes Verhältnis gehabt habe, das über zwei Jahre gegangen, aber jetzt zu Ende sei", und kurz darauf in Berlin ausruft: "Hier weiß man ja, dass ich kein Säulenheiliger bin." Da steht die Frau, die für den Politiker wie für den Menschen Willy Brandt ein Glücksfall war, die seine drei Söhne erzogen hat und für die Außendarstellung, vor allem des Berliner Aufsteigers, unverzichtbar gewesen ist, da also steht Rut Brandt daneben wie vom Schlag gerührt und lächelt doch mit den anderen.
Was Schöllgen über die Anfänge der Beziehung zu Rut herausgefunden hat, gehört zu den bemerkenswertesten Passagen des Buches: Mit der Gründung seiner neuen Familie endet für Brandt eine schwierige Zeit. Bis zum Frühjahr 1947, als Rut Bergaust endgültig nach Berlin kommt, ist er, wenn nicht unterwegs, allein an der Spree und wohl auch ziemlich einsam. Mutter, Stiefvater und Halbbruder sind in Lübeck; die Geliebte, die Ehefrau, von der er noch nicht geschieden ist, und die Tochter leben in Oslo. Brandt vermisst die drei, jede auf besondere Weise; und aus dieser Situation entwickelt sich eine lebenslange, bewegende Geschichte. Sie zeigt einen Mann, den die Öffentlichkeit kaum wahrgenommen hat.
Serie von Briefen
Brandt bringt damals eine ganze Serie von Briefen auf den Weg nach Oslo. Die Zahl geht in die Hunderte, und die Adressatinnen sind Ninja, Carlota und vor allem Rut: Ihr schreibt der künftige Ehemann Tag für Tag, mitunter bis zu drei Briefe, alle ordentlich nummeriert. Bei Carlota erkundigt er sich teilnahmsvoll nach ihren Lebensumständen in dieser schwierigen Zeit, und der Tochter erzählt er von sich und bittet das Mädchen, das gerade schreiben lernt, um einige Zeilen oder ein selbst gemaltes Bild.
Die drei Frauen bleiben ein Leben lang in Verbindung. Eine sehr enge Bindung entsteht zwischen Rut und Ninja. Carlotas Tochter ist gewissermaßen das vierte Kind der Familie Brandt. Als Rut im Sommer 1949 mit ihrem zehn Monate alten Sohn Peter von einem Familienbesuch aus Norwegen nach Berlin zurückkehrt, ist Ninja dabei, um den Vater zu besuchen. So hält man es bis in die 70er Jahre. Wenn die Brandts Urlaub machen, ob im Allgäu oder in Tunesien, ist Ninja häufig mit von der Partie.
Der Kontakt bleibt auch nach Brandts Heirat mit Brigitte Seebacher bestehen. Besonders zu Ninjas 1984 geborenen Tochter Janina entwickelt der inzwischen über 70-Jährige ein inniges Verhältnis. Mal besucht er die Enkelin in Oslo, mal reist Janina mit den Eltern zum Großvater nach Südfrankreich. In Gagniere hat Brandt ein Bauernhaus gekauft, in das er sich nach seinem Rücktritt als SPD-Vorsitzender 1987 immer häufiger zurückzieht. Dort wohnen alle unter einem Dach, und man darf wohl annehmen, dass Brigitte Seebacher-Brandt in diesem Beisammensein etwas von jener familiären Atmosphäre gespürt hat, die ihr die Ehe mit Brandt nicht bieten konnte.
Die Journalistin und Historikerin, Jahrgang 1946, hat Brandt 1977 als Redenschreiberin engagiert; obwohl noch mit Rut verheiratet, nimmt er sie mit auf Reisen. Die Ehefrau ist, wie oft, ahnungslos, weiß nicht einmal, dass Brigitte Seebacher ihren Mann nach einem Herzinfarkt im französischen Hyeres päppelt. Erst nach seiner Rückkehr schenkt Willy der Gattin reinen Wein ein - und lässt kurz darauf mitteilen, sie hätten sich verständigt, "die rechtlichen Schritte für eine Auflösung ihrer Ehe einvernehmlich einzuleiten".
Produktive Gemeinschaft
Fortan kümmert sich Brigitte um ihn: Seine dritte Ehe ist eine ebenso produktive wie erfolgreiche Arbeitsgemeinschaft. Gewiss hat es Brigitte Seebacher nicht geschadet, "die Frau von Willy Brandt" zu sein, wie es im Klappentext zu ihrer 1988 publizierten Biografie August Bebels heißt. Als sie an ihrer Dissertation über den früheren SPD-Chef Erich Ollenhauer arbeitet, trägt Brandt mit einem umfangreichen Konvolut größtenteils handschriftlicher Aufzeichnungen einiges zur Materialbasis bei.
Ihr Einfluss auf den Gatten ist enorm; er reicht von der Wahl der meist kräftig gestreiften Hemden mit mehr oder weniger passender Krawatte bis zu einer geänderten Lebensweise: Die Kost ist gesund, Frauengeschichten gibt es nicht mehr. Bei Terminen trinkt Brandt zwar weiter gern Rotwein und schnorrt Zigaretten, bittet aber darum, nicht zu petzen: "Brigitte sieht das nicht gerne." Die strenge, allenfalls rechtssozialdemokratische Gemahlin führt dem Politiker auch oft die Feder; in seinen Artikeln ist zum Befremden der Genossen ihre Handschrift mit der Zeit deutlich zu erkennen, in seinem letzten Buch, "Erinnerungen", sogar in weiten Partien. Über Rut findet sich auf fast 800 Seiten kein Wort.
Nachdem Brandt Ende 1991 an Darmkrebs erkrankt ist, pflegt ihn Gattin Nummer drei aufopferungsvoll. Sie schottet ihn ab im Unkeler Haus , lässt nur vor, wer vor ihren Augen Gnade findet. Sogar Michail Gorbatschow, der unangemeldet klingelt, weist die Hausherrin ab - sie bezweifelt, dass wirklich der einst mächtigste Mann der Sowjetunion vor dem Gartentor steht.
Dass sich Brigitte Seebacher bald nach dem Tod ihres Mannes von restlos allem trennt, was an die gemeinsamen Jahre erinnert, spricht für sich: Möbel, Bilder, Bücher, intime Korrespondenzen - alles nimmt leidenschaftslos seinen Weg ins Archiv.
Mythos Brandt
Den Mythos Brandt aber, den er so lange pflegte, kann selbst sie nicht mehr zerstören. Er stand zu seinen Schwächen, auch das machte einen Teil seines Nimbus aus. "Dieser Willy Brandt", sagt er im September 1972, "so wie er geworden ist und so alt wie er jetzt auch geworden ist, den funktioniert keiner mehr um." Die Menschen spüren: Dieser Mann ist nicht einer jener gefühlskalten, hemdsärmeligen Karrieristen, kein Machtmensch, im Gegenteil. Im Zentrum der Macht angekommen, lässt er bezeichnenderweise keinen jener Züge erkennen, die andere dort alsbald annehmen. Er wird weder zum Zyniker, noch entwickelt er nennenswertes Misstrauen gegenüber seiner Umgebung. Vor allem aber hält er sich zu keinem Zeitpunkt für unersetzlich.
Robustere Naturen hätten Guillaume-Affäre und Weibergeschichten, wie von Scheel empfohlen, "auf einer Backe" abgeritten, zumal die Liste mit den angeblichen Liaisons zwar lang, aber wenig präzise war. Namen sind Mangelware. Überhaupt nur vier sind es, darunter ein Name, den die Gewährsleute nicht einmal korrekt zu buchstabieren wissen. Im Übrigen sind den Schnüfflern bestenfalls der Beruf beziehungsweise die Nationalität der einen oder anderen Dame erinnerlich.
Aber Brandt war im Mai 1974 einfach fertig. "In Wahrheit war ich kaputt, aus Gründen, die gar nichts mit dem Vorgang zu tun hatten, um den es damals ging", erinnert er sich später. In der Karrierefalle ortet ihn Biograf Schöllgen im Nachhinein, in einem den Quartalsdepressiven auf Dauer überfordernden Amt. Immer wieder mussten ihn seine engsten Mitstreiter davon abbringen, den Krempel hinzuwerfen. Regelmäßig klinkte sich "jener in sich zurückgezogene Mann, den ich Willy nenne", wie Günter Grass ihn charakterisierte, einfach aus und legte sich tagelang zu Hause ins Bett. Nix hören, nix sagen, nix kanzlern.
"Willy, aufstehen, wir müssen regieren"
Bezeichnend die Szene, als Kanzleramtsminister Horst Ehmke dringend Unterschriften benötigte und mit einer Flasche Rotwein und zwei Gläsern bewaffnet bei Brandt auftauchte: "Willy, aufstehen, wir müssen regieren." Damit brachte er den Chef wenigstens auf die Beine. Im Hausmantel trank er mit. Beide schwiegen sich lange an. Dann brummte Brandt: "Schmidt und Wehner sind Armleuchter."
Später, auch das gehört zum zwiespältig-schillernden Bild Brandts, hat der Kettenraucher ernsthaft den ärztlich angeordneten Nikotinentzug in den Jahren 1973 und 74 für seinen Rücktritt verantwortlich gemacht: Er habe "wie ein Hund gelitten", jeden Tag zwei Fehler begangen, es auch gewusst, aber nicht ändern können. Ein Süchtiger. Nach Tabak, nach Frauen, nach Alkohol. "Er trinkt", bemerkte US-Außenminister Henry Kissinger kühl nach einem Treffen mit Brandt.
Nach seiner Demission macht Brandt das, was er stets nach Rückschlägen getan hat: Er schreibt ein Buch und reist - zwei Varianten eines Grundverhaltens: Sowohl das Reisen, bei dem man nach vorne schaut, als auch die rückwärts gewandte Erinnerung vermeiden den Blick auf die Gegenwart mit ihren Ängsten, Schmerzen und Niederlagen. Der Hang zum Eskapismus ist verständlich, denn einstecken musste Brandt reichlich: zwei Bundestagswahlen als Spitzenkandidat verloren (1961 fliegt er danach in die USA, obwohl seiner Frau eine riskante Entbindung bevorsteht), zweimal beim Kampf um den SPD-Vorsitz in Berlin gescheitert, in den 50er Jahren zweimal beim Versuch abgeschmiert, in den Bundesvorstand zu kommen.
Weit unten
Als er 1956, inzwischen 42 Jahre alt und Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, wieder nicht in das Gremium gewählt wurde und das Ergebnis während einer Dampferfahrt auf dem Starnberger See durchsickerte, sah man einen hemmungslos weinenden Willy Brandt. So weit unten, sagen Weggefährten, sei er nie mehr gewesen.
Es erstaunt wenig, wenn einer wie Brandt glaubt, dass "jedes Leben von innen her gesehen nichts weiter als eine Kette von Niederlagen ist". Das jedenfalls notiert er in seiner unverwechselbaren Handschrift auf einen jener Zettel, die in unregelmäßigen Abständen ihren Weg in zwei Aktenmappen mit Zitatensammlungen finden.
Aber dieser widersprüchliche Mensch mit seiner außerordentlichen Fähigkeit, neu zu beginnen, wiederbelebt sich jedes Mal selbst, rappelt sich auf. Wobei ihm, auch das gehört zu diesem vielschichtigen Charakter, nicht zuletzt hilft, dass er nie sein künftiges Bild in den Geschichtsbüchern aus den Augen verliert.