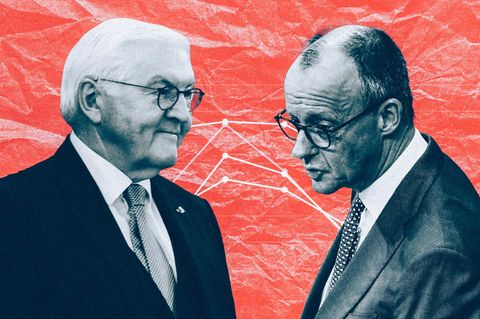Making-of heißt unser neues Format. Wir wollen Ihnen einen persönlichen Blick hinter die Kulissen ermöglichen, aus unserem journalistischen Alltag erzählen und von unseren Recherchen. Wir beginnen mit einer kleinen Serie, in der wir auf unsere Momente des Jahres 2023 zurückblicken.
Ziemlich genau ein halbes Jahr ist es her, dass mein Kollege Jan Rosenkranz und ich ein Interview mit Alice Weidel führten. Ich denke häufig daran. Wir besuchten die AfD-Vorsitzende in ihrem Bundestagsbüro, es war ein warmer Tag, und oberflächlich gesehen hätte man glauben können, es handele sich um einen vergleichsweise normalen Termin.
Weidel nahm sich Zeit für Fotos. Sie führte durch ihre Räumlichkeiten im sechsten Stock des Jakob-Kaiser-Hauses, zeigte den Blick von ihrem Schreibtisch über den Tiergarten, erschien locker und freundlich. Unheimlich freundlich, genau genommen. Als trage sie eine Maske, eine zweite Haut mit einem Lächeln, das während des Gesprächs so gar nicht zu den Ungeheuerlichkeiten passte, die in der einen Stunde immer wieder aus ihr herausplatzten.
Rechtsextreme? Gibt es aus ihrer Sicht nicht in der AfD. Beamte der EU-Kommission? Sollten alle schleunigst gefeuert werden. Solche Sachen.
Gegen Ende des Interviews sprach ich sie auf die Diskrepanz zwischen ihrem persönlichen Hintergrund und ihren politischen Haltungen an. "Wir wundern uns manchmal, wieso eine Frau, die mit einer Partnerin aus Sri Lanka zusammenlebt …"
"… sie ist Schweizerin", fuhr Weidel dazwischen.
Daraufhin ich: "… aber sie wurde in Sri Lanka geboren."
"Aber mit drei Monaten adoptiert. Warum betonen Sie das so?", fragte Weidel. Sie war offenkundig erfreut darüber, bei mir jene Herkunftsobsession erkannt zu haben, die wir an der AfD in der Regel kritisieren.
Für einen kurzen Augenblick war ich perplex, suchte nach einem Konter, was Journalisten schon mal passiert. Aber ausgerechnet jetzt? Glücklicherweise sprang Jan ein, sagte: "In der Logik Ihrer Partei ist sie auf ewig Migrantin. Daraus entlässt die AfD doch selbst Menschen nicht, die in dritter Generation hier leben." Und wir waren wieder in der Spur.
Wie gehen wir Medien mit der AfD um?
Ich habe den Moment trotzdem noch mit leichter Beklemmung in Erinnerung, weil ich dabei etwas über mich gelernt habe, vielleicht sogar etwas über den journalistischen Umgang mit der AfD grundsätzlich. Kann es sein, dass ich aus einem Gefühl der moralischen Überlegenheit heraus glaubte, Weidel jederzeit stellen zu können – und dabei selbst gestellt wurde?

Es ist in diesem Jahr viel über darüber diskutiert worden, wie Medien über die AfD berichten sollten, wir selbst haben die Kontroverse mit dem Interview in Teilen ausgelöst. Es gab Lob für unsere Idee, Weidel zu interviewen und daraus einen stern-Titel zu machen, aber auch viel Kritik, von Kolleginnen und Kollegen, in den sozialen Medien. Kern der Kritik war, dass ein Magazin einer Frau keine Bühne bieten dürfe, deren Partei die freiheitliche Grundordnung infrage stellt und in Teilen als rechtsextrem eingestuft ist. Jedes Interview "normalisiere" die AfD, und das ausgerechnet in einer Zeit, in der die Partei zu gewaltiger Kraft heranzuwachsen scheint.
Wir haben diese Kritik ernst genommen, in der Redaktion diskutiert, bei uns im Berliner Büro. Manche Kritik war berechtigt. Zum Beispiel hätten wir Weidel an der einen oder anderen Stelle noch klarer widersprechen können. Aber die Beharrlichkeit hat auch ihre Grenzen, weil die Gefahr besteht, dass ein Interview in ein erregtes Verhör kippt und man den Eindruck erweckt, immer das letzte Wort haben zu wollen. Souverän wirkt auch das nicht. Sympathien provoziert ein solcher Ansatz, wenn überhaupt, mit der "Verhörten".
Den Kern der Kritik finde ich allerdings aus mehreren Gründen falsch. Einer davon ist, dass der bisherige Ansatz, Interviews mit führenden AfD-Vertretern zu meiden, so richtig gut ja nicht funktioniert hat. Ansonsten wäre die Partei in Umfragen nicht dort, wo sie ist. Und offen gestanden finde ich auch das Argument mit der Bühne wenig überzeugend, da im Zeitalter der sozialen Medien AfD-Politiker wie Frau Weidel so viele eigene Bühnen und Wege haben, sich zu verbreiten und zu präsentieren, dass Interviews in Magazinen und Zeitungen aus ihrer Sicht eher verzichtbar wirken dürften.
Mehr Unvorhersehbarkeit wagen
Ich glaube, wir Journalisten müssen ihren Spitzenkräften schon in die Augen gucken, nicht weggucken. Die AfD ist keine Nischenpartei mehr, sie hat sich in der Politik trotz niederträchtiger Positionen etabliert oder vielleicht gerade deswegen.
Natürlich gehört zu einer guten AfD-Berichterstattung, die rechtsextremistischen Umtriebe in der Partei zu thematisieren. Aber mit Blick auf die Erfahrungen dieses Jahres scheint mir, dass es der AfD womöglich sogar helfen würde, wenn wir die Berichterstattung nur darauf begrenzten, die Partei bis tief in alle Verästelungen nach demokratiefeindlichen Tendenzen zu durchleuchten. Paradoxerweise stärkt der Journalismus ihr Outsider-Image, wenn er ihre Tabubrüche nachzeichnet, oder anders formuliert: Je aggressiver Medien versuchen, die AfD zu delegitimieren, desto größer wird ihre Anziehungskraft.

Das stellt uns Journalisten vor ein schwieriges Dilemma: Wir können die Gesinnung der AfD nicht unter den Teppich kehren, müssen aber gleichzeitig den Eindruck vermeiden, es nur auf die Zerstörung dieser Partei abgesehen zu haben. Letzteres ist auch nicht unsere Aufgabe. Manche mögen das anders sehen, aber ich glaube, dass wir künftig die penible, hartnäckige Beobachtung mit weniger Vorhersehbarkeit ausbalancieren sollten, mit nüchterner Analyse, die die Attraktivität der AfD erklärt und etablierten Parteien den Spiegel vorhält, mit Berichten von vor Ort. Und, ja, mit direkten Gesprächen mit ihren Spitzenvertretern.
Auch wir Journalisten lernen von der direkten Konfrontation
Auch als Journalist lernt man von solchen Terminen, das habe ich aus dem schwierigen Moment im Weidel-Gespräch mitgenommen. Interviews mit AfD-Politikern sind ein Test – auch für uns selbst. Sie zwingen uns dazu, unsere Herangehensweise zu überprüfen, unsere Haltungen zu hinterfragen, weniger moralisch zu argumentieren, dafür handwerklich präziser zu sein, um die Achillesfersen von Rechtspopulisten zu finden.
Wenn dieses Jahr etwas gezeigt hat, dann, dass die AfD nicht nur extremer geworden ist, sondern auch professioneller. Sie kommuniziert besser als viele andere Parteien, weiß genau, wen sie auf welchem Wege anspricht, ist nicht immer, aber doch immer häufiger gewappnet für verschiedenste Vorwürfe. In Interviews kann das schon mal einen unangenehmen Moment hervorbringen.
Aber nach diesem Jahr weiß ich nicht nur, wie hilfreich es ist, einen guten Interviewpartner an meiner Seite zu haben. Ich weiß auch: Solche Gespräche machen uns Journalisten besser – nicht schlechter.