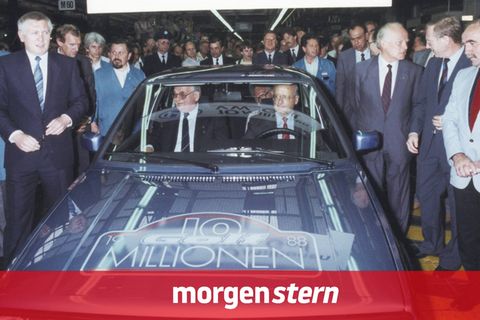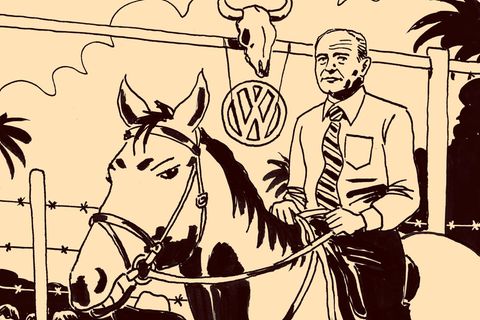Vor nicht allzu langer Zeit galt der Posten des VW-Chefs als einer der meistbegehrtesten Jobs der Bundesrepublik. Martin Winterkorns regierte sein Zwölf-Marken-Reich mit eherner Hand und die Paladine brachten sich in Stellung, um den Herrscher zu beerben. Von dem niedersächsischen Camelot ist nach Ausbrechen des Diesel-Skandals nicht mehr viel übrig. Die VW-Führung musste den Hut nehmen und hinterließ ein Machtvakuum, das nur schwer zu füllen ist. Zu allem Überfluss verließ mit Winfried Vahland ein Hoffnungsträger den Konzern.
Glaubt man der Gerüchteküche, wollte ehemalige Skoda-Boss, der einst selbst als Kronprinz gehandelt wurde, nicht als USA-Chef an den neuen VW-Markenchef Herbert Diess berichten und hat die Konsequenzen gezogen. Noch mehr Abgänge dieser Art kann sich Volkswagen nicht erlauben, denn sonst gehen dem Konzern die fähigen Führungskräfte aus. Auch ein Resultat des Alleinherrschaftsanspruchs des eingeschworenen Zirkels um Martin Winterkorn. In ihrer Verzweiflung holten die VW-Manager Stefan Knirsch zurück, der eigentlich schon bei Mercedes als Technik-Vorstand vorgesehen war und machten ihn bei Audi zum Nachfolger des zurückgetretenen Technik-Chefs Ulrich Hackenberg.
Der neue starke Mann in Wolfsburg, Matthias Müller, hat derweil alle Hände voll zu tun, die Brandherde im Konzern zu löschen. Momentan scheint es aber so, als ob seine zwei Hände nicht ausreichten, um die vom Dieselgate befeuerte Flammen zu ersticken. Jetzt musste der VW-Chef auch noch den Canossagang nach Katar antreten, um die Verantwortlichen des VW-Großaktionärs "Qatar Investment Authority" (QIA) wieder milde zu stimmen. Angeblich sind die Scheichs ob des Diesel-Skandals, der ihnen Verluste in Milliardenhöhe bescherte, ziemlich verstimmt. Laut eines VW-Sprechers waren der Betriebsrat und die Mitbestimmung allerdings nicht Teil dieser Abstimmungsgespräche.
Ehe sich Müller an den Umbau des Konzerns machen kann, hat er immer noch mit den Auswirkungen des Dieselskandals zu tun. Die Dimensionen des Brandherds sind gigantisch: Bei rund elf Millionen Motoren, die quer über den VW-Konzern verstreut sind, ist die Schummel-Software installiert. Mittlerweile haben die Ingenieure eine erstaunlich einfache Nachrüstlösung präsentiert, die zumindest bei den 1.6-Liter-Motoren das Problem beheben soll. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat diese Maßnahmen, die im Grunde aus einem Plastikgitter und einem Software-Update besteht, akzeptiert. Bei den betroffenen Zweiliter-Dieseln reicht angeblich ein Software-Update, bei den 1.2-Liter-Motoren steht die das formelle "Placet" des KBA noch aus. In Europa käme Volkswagen damit relativ günstig weg. Ersten Berechnungen zufolge würde dieser Rückruf den Wolfsburgern rund 500 Millionen Euro kosten.
Ob das in den USA reicht, bleibt abzuwarten. Dort sind vermutlich technisch aufwendigere Lösungen nötig. Indes wächst der Druck weiter. Die Amerikaner erwarten handfeste Vorschläge, wie die Motoren die vorgeschriebenen Werte erfüllen können. Seitdem bekannt wurde, dass auch die Dreiliter-Diesel, die auch in den Modellen von Audi und Porsche verbaut sind, ebenfalls manipuliert wurden, gerät der stolze Konzern noch mehr in die Defensive. Schließlich hatte VW noch vor wenigen Wochen dementiert, eine solche Software in den großen Dieselmotoren verwendet zu haben. Jetzt steht nicht nur Matthias Müller, sondern auch Audi-Chef Rupert Stadler schlecht da. Angesichts dieser neuen Lügen-Attacke fragen sich die Ermittler, was es mit Ehrlichkeitsbekundungen der VW-Spitze auf sich hat. Stadler soll, als ihm offenbart wurde, dass auch bei den Dreiliter-Aggregaten geschummelt wurde, aus der Haut gefahren sein. Derweil droht die kalifornische Umweltbehörde mit harten Strafen, falls nicht bald Lösungen aus Wolfsburg kommen, wie die Motoren sauber zu bekommen sind.
Der Domino-Effekt setzt sich fort. Auch in den Autohäusern macht sich das Abgas-Debakel mittlerweile bemerkbar: In Deutschland verkaufte VW im November 57.923 Autos, das sind zwei Prozent weniger, als im Jahr zuvor. In den USA brach der Umsatz sogar um 25 Prozent ein. Davon unbenommen ist die zu erwartende Klagewelle in den USA, die den VW-Konzern voraussichtlich Milliarden kosten wird. Deswegen haben die Wolfsburger 6,7 Milliarden Euro auf die Seite gelegt. Das Minus vor Steuern betrug alleine im dritten Quartal dieses Jahres 3,5 Milliarden Euro, unterm Strich blieben davon noch 1,7 Milliarden übrig.
Derweil nimmt das Unheil seinen Lauf: Die EU erwägt aufgrund der Manipulation, Strafen zu verhängen. In Frankreich ließ die Staatsanwaltschaft die Räume der VW-Konzernzentrale untersuchen und hat bereits Vor-Untersuchungen wegen schweren Betrugs aufgenommen. Auch in Italien und Spanien laufen Ermittlungen. Die Schweiz hat ein Verkaufsstopp der Fahrzeuge mit dem betroffenen Dieselmotor (EA 189) verhängt. Österreich hat den Rückruf von mehr als 360.000 VW-Modellen angeordnet. Auch in Australien werden Sammelklagen vorbereitet.
Dagegen kommt VW in Brasilien mit einer Strafe von mehr als zwölf Millionen Euro und der Nachrüstung von rund 17.000 Amarok noch glimpflich davon. Um finanziell gewappnet zu sein, hat sich VW bei Banken 20 Millionen Euro besorgt. Gleichzeitig wird an allen Ecken und Enden gespart. Der Marktstart des Prestige-Autos Phaeton wird verschoben und jede neue Investition auf den Prüfstand gestellt. Das könnte sich fatal beim Wettrennen in der E-Mobilität auswirken.