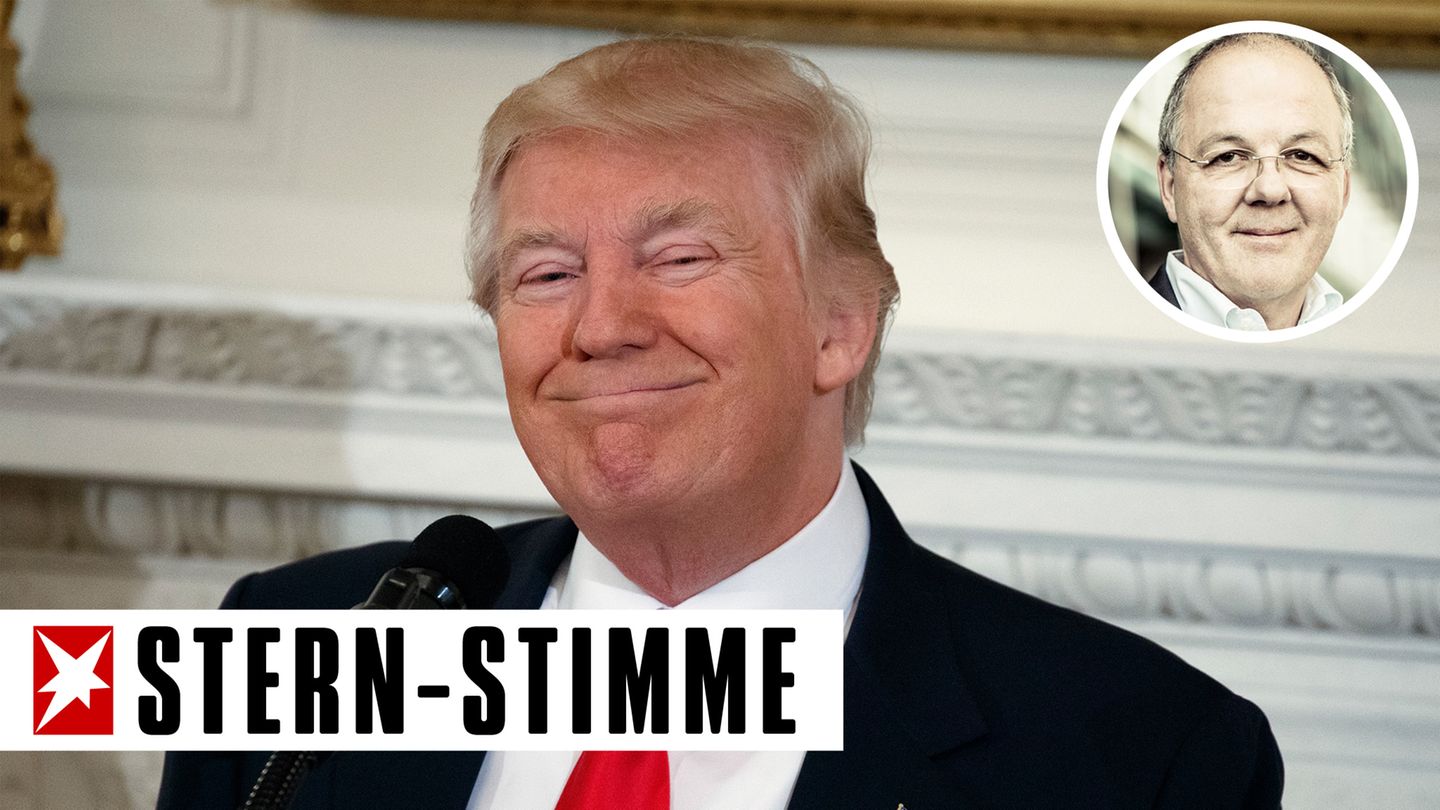Eigentlich dachte ich, die Sache sei längst klar. Wer glaubt, dass Facebook vor allem dazu dient, dass wir ständig mit unseren Freunden vernetzt sind, wir unsere Vorlieben teilen oder uns lustige Bilder und Videos hin- und herschicken, der glaubt vermutlich auch noch an den Osterhasen - oder an das Gute im Gutmenschen Marc Zuckerberg. Das Neueste aus dem Weltreich Facebook: Über eine App sollen die Profile von 50 Millionen Benutzern abgezogen worden sein, weil die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica damit im US-Wahlkampf Stimmung für Donald Trump machen wollte.
Facebook wusste wohl schon seit längerem davon, hielt es aber offenbar für angebracht, erstmal vornehm zu schweigen. Dann eine erste Pressemitteilung, Cambridge Analytica habe die Daten missbraucht und gelogen. Dann endlich stellte sich Marc Zuckerberg. "Wir tragen die Verantwortung, Eure Daten zu schützen", gab er sich kleinlaut und ein wenig reumütig, "und wenn wir das nicht können, verdienen wir Euch nicht."

Thomas Ammann: Bits & Pieces
Stellvertretender Chefredakteur des stern, 60, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Netzpolitik und den sozialen Aspekten der digitalisierten Gesellschaft, der internationalen Hackerszene und der Computerspionage, zuletzt als Co-Autor des im Herbst 2014 erschienenen Buches "Die digitale Diktatur – Totalüberwachung, Datenmissbrauch, Cyberkrieg".
Geschäft Facebook
Verdienen ist das Stichwort. Nur mal ein paar Zahlen zu Facebook: Börsenwert in Dollar: 492,6 Milliarden; Umsatz im vergangenen Jahr: 40,7 Milliarden; Gewinn im vergangenen Jahr: 15,9 Milliarden. Das ist eine Umsatzrendite von fast 40 Prozent! Ein besseres (legales) Geschäft gibt es zurzeit wohl nirgends auf der Welt. Und das lässt sich nicht allein mit der Werbung machen, mit der die User gezielt beeinflusst werden sollen, sondern womit? Ja, genau. Mit dem Verkauf von Daten an mehr oder weniger jeden, der sie brauchen kann. Rund 2,1 Milliarden eingetragene Benutzer gibt es inzwischen, ein knappes Viertel der Menschheit. Und Facebook, das ist das Geschäftsgeheimnis, weiß alles über seine User, also uns.
Solange wir Werbung für Sneaker, Klamotten oder irgendwelches andere Zeugs bekommen, scheint das niemanden zu stören. Aber Trump? Da hört der Spaß auf.
Datensammeln um jeden Preis
Jetzt sind alle wieder pflichtgemäß entsetzt. Die neue Justizministerin Katarina Barley hat ihr erstes großes Thema gefunden. Sie lädt Facebook nach Berlin und fordert Aufklärung, wie der Konzern "die Wiederhoung solcher Fälle" verhindern will. Was genau sie damit meint, verrät sie nicht. Aber auch sie hat erkannt: Wer den kostenlosen Service nutze, zahle mit seinen Daten, meinte die Justizministerin.
Exakt. Schon vor Jahren haben Datenschutz-Aktivisten darauf hingewiesen, dass Facebook heimlich Daten von Usern sammelt, die keine eingetragenen Facebook-Mitglieder sind; dass Facebook ohne Zustimmung des Betroffenen persönliche Daten "absaugt", beispielsweise über die iPhone-App oder den Import von E-Mail, und diese für eigene Zwecke verwendet - sprich weiterverkauft. Auch sei der "Like Button" nicht datenschutzkonform und könne zum Ausspionieren der Nutzer verwendet werden.
Das Monster füttern
Denn darum geht es: Möglichst viele Informationen von den Benutzern und ihren Freunden zu sammeln. Das ist die eigentlich wertvolle Währung bei diesem Geschäft. Gestört hat es bisher offenbar niemanden. Im Gegenteil. Alle machen fröhlich mit und füttern das Monster Tag für Tag.
Bis zu sechzig Merkmale werden regelmäßig über die Facebook-Benutzer gespeichert: Wo sie sich gerade befinden, welches Gerät sie benutzen, welche Seiten sie aufrufen, wie lange sie auf diesen Seiten verweilen, welche Freunde man hat, was ihnen gefällt (Like-Buttons), mit wem sie aktuell kommunizieren, welche Fotos sie hoch- oder herunterladen und so weiter. Niemand sollte sich in der Sicherheit wiegen, die Eingaben seien anonym. Durch die Verknüpfung aller Merkmale ist es ein Leichtes, den jeweiligen Benutzer eindeutig zu identifizieren und ihn im Zweifel namentlich zu benennen. Allein dieses Wissen hat die Internetkonzerne mit ihren Milliardengewinnen in die höchsten Sphären der New Economy katapultiert.
Gift für die Politik
Und jetzt wird es auch mehr und mehr für politische Werbung bis hin zur Propaganda eingesetzt. "Data driven persuasion efforts" heißt das im Englischen, zu Deutsch etwas sperrig also: "Datengetriebene Überzeugungsbemühungen". Man kann auch sagen, Daten werden als Waffe im politischen Kampf genutzt. Die Frage ist, wie wirksam solche Methoden sind. Nicht jeder, der mit Werbung für Sneakers bombardiert wird, bestellt sie auch gleich. Und nicht jeder, der im US-Wahlkampf mit rechter Propaganda oder mit Fake-News über die Kandidatin Hillary Clinton konfrontiert wurde, lief gleich zu Trump über.
Aber das Gift wird sozusagen langsam eingeträufelt, und die Methoden für das "Targeting" werden immer mehr verfeinert. In Frankreich hat Giullaume Liégey mit seinem Datenanalyse-Start-up LMP einem Präsidentschaftsbewerber mit zum Erfolg verholfen, der praktisch aus dem Nichts kam: Emanuel Macron. Allerdings nicht allein mit Nutzerprofilen und Datenanalysen, sondern mit einer Kombination aus Hightech und Haustürwahlkampf. "Menschen lassen sich am besten von Menschen überzeugen", sagte Liégey gerade bei einem Auftritt auf dem OMR Festival in Hamburg. "Ohne richtig gute Leute bringt einer Partei die beste Technik nichts." Seine ersten Erfahrungen hat Liégey übrigens 2008 als Social Media-Experte im Wahlkampfteam von Barack Obama gemacht.
Der jüngste Skandal um Facebook und Cambridge Analytics wie auch die Debatte um Fake-News im Netz haben gezeigt: Die Gefahren werden größer und nicht kleiner, und die Internetkonzerne agieren bestenfalls im Graubereich. Als erste Gegenmaßnahme sollte man mal endlich damit anfangen, dass Werbung - ganz gleich, ob politische oder kommerzielle - erkennbar und unmissverständlich als solche gekennzeichnet wird, wie es bei "klassischen" Medien der Fall ist.

Von selbst ändert sich nichts
Wir haben die Kontrolle über unsere Daten fremden Mächten übertragen, die sich selbst jeder Kontrolle entziehen, auch wenn der Schutz der Privatsphäre in Europa deutlich weiter reicht als in den USA. An ihrem Geschäftsmodell werden Facebook, Google & Co. freiwillig nichts ändern, dafür ist es zu lukrativ. Immerhin: Weil erste Werbekunden drohen abzuspringen, gerät Facebook unter Druck.
In dem Maße, in dem sich unser Leben und unsere Persönlichkeit mehr und mehr im Internet abbilden, müssen die digitalen Persönlichkeitsrechte Schritt halten. In naher Zukunft werden nicht nur alle Kommunikations-, Bewegungs- und Finanzdaten online verfügbar sein, sondern auch alle genetischen und medizinischen Informationen. Spätestens dann muss das "digitale Ich" vergleichbare Rechte genießen wie das "reale Ich". Die vollständige Kontrolle über möglichst alle gespeicherten Daten gehört dazu.
Das Ende der Selbstkontrolle
Für Politik und Aufsichtsbehörden wird deshalb kein Weg daran vorbeiführen, die Internetkonzerne zu verpflichten, ihre Nutzer zu informieren und sie explizit um ihre Einwilligung zu bitten, wenn Daten an Dritte weitergegeben werden sollen.
Marc Zuckerberg will jetzt erstmal "sicherstellen, dass es keine weiteren Cambridge Analyticas da draußen" gibt. Wo immer "da draußen" ist: Ich fürchte, es gibt viel zu viele Cambridge Analyticas.