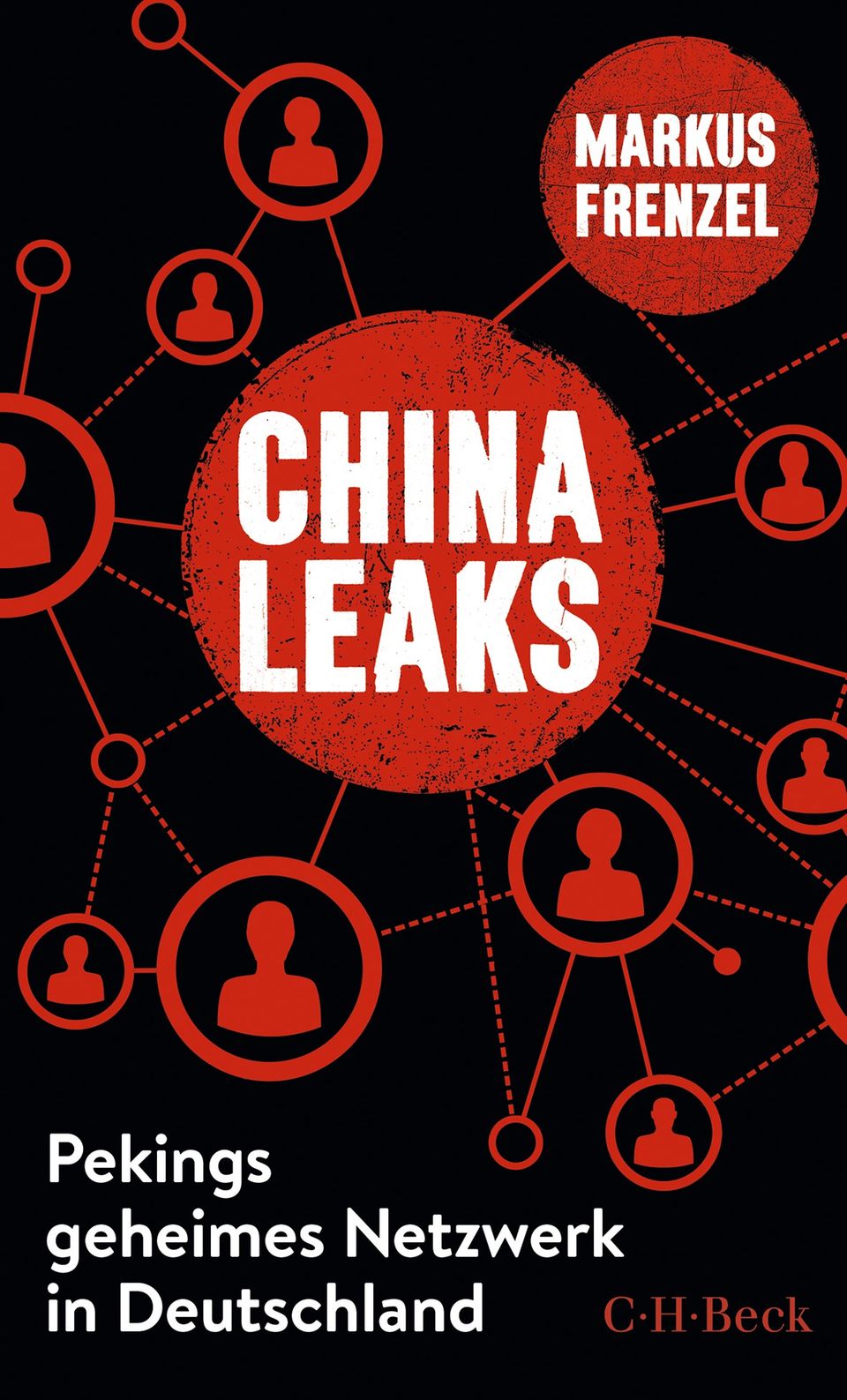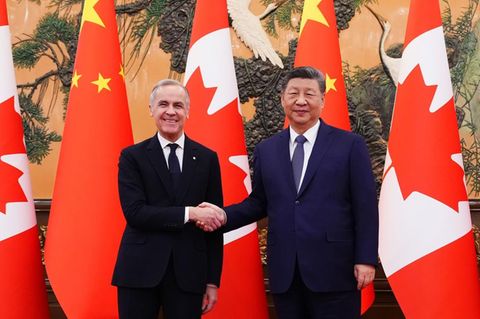Auf einmal stand der Mann mitten in ihrem Büro. Sie hatte ihn nicht eintreten sehen und eigentlich auch niemanden mehr erwartet. Eigenartigerweise hatte auch der Empfang den Besucher nicht gemeldet. Der Mann zuckte seinen Dienstausweis. Verfassungsschutz? Die ältere Frau starrte den Fremden an und begann zu zittern. Was konnte der Inlandsgeheimdienst nur von ihr wollen? Sie lebte schon lange in dem Ort in Süddeutschland, verrichtete pflichtbewusst ihre Arbeit im örtlichen Stadtmuseum, führte ein braves bürgerliches Leben. Nichts Aufregendes, deutscher Alltag. Auch hatte sie weder Kontakte zu extremistischen Zirkeln noch zu den Vertretern fragwürdiger Diktaturen am anderen Ende der Welt. "Es geht um Ihren Sohn", sagte der Mann sofort, "aber Sie brauchen keine Angst haben." Dann überlegte er kurz: "Zumindest noch nicht."
Über die Mutter hoffte der Spitzel unauffälliger in Kontakt mit dem Sohn treten zu können – eine richtige Annahme. Bald darauf kam es zu einem Treffen in einer europäischen Hauptstadt. Ein Agent des Dienstes, Abteilung Gegenspionage, verabredete sich mit dem jungen Mann in einem Café. Um ihn zu schützen, nennen wir ihn Lutz Heppner. "Sie haben nichts Illegales getan", versicherte der Geheimdienstmitarbeiter gleich zu Beginn des Treffens, "aber ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten." Dann kam der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes sofort zur Sache. "Die Chinesen interessieren sich für Sie." Für Heppner kam diese Erkenntnis nicht überraschend, das hatte er selbst schon festgestellt. Und ungewöhnlich schien ihm das auch nicht, immerhin hatte er Sinologie studiert. Während der Zeit an der Uni, insgesamt vier Jahre, lebte er mehr in Peking als in der deutschen Stadt, in der er eingeschrieben war. Und jetzt promovierte er mit einer Dissertation zu dem Land der Mitte, arbeitete für eine kleine Organisation zu China, organisierte Fachkonferenzen, schrieb Forschungspapiere und kam regelmäßig mit anderen Experten zusammen. Da wäre es bedenklicher gewesen, wenn sich die Chinesen nicht für ihn interessiert hätten.
Erst kürzlich hatte ihn auf einem Abendempfang bei einem Glas Sekt ein Vertreter der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua angesprochen. Der Mann war überrascht, wie gut Heppner Chinesisch sprach. Er befragte ihn zu seinem Promotionsthema, zeigte sich beeindruckt von dem profunden Wissen, das Heppner über China besaß. Irgendwann schlug er dem Deutschen vor, dass er für Xinhua einmal einen Text schreiben konnte. Ungefähr drei Seiten. Dafür würden sie zwischen 700 und 1000 Euro zahlen. Für den Promotionsstudenten schien das Angebot nicht übertrieben hoch. Er wolle es sich überlegen, antwortete er. Gerade hatte Heppner seine Dissertation abgegeben, wartete noch auf das Ergebnis. Der Job, den er machte, war sicher nur eine Notlösung. Mal sehen, was da noch so kommen sollte. Das Treffen war erst einige Tage her. "Im vergangenen Monat haben wir 35 Anwerbeversuche von chinesischen Diensten bei Ihnen festgestellt", sagte der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in dem Café. Es erwischte Lutz Heppner wie ein Schlag in die Magengrube. 35 Versuche? In einem Monat? "Das ging schon weit über das hinaus, was ich erwartet hatte", erinnert sich Heppner heute an das Treffen mit dem Geheimagenten.