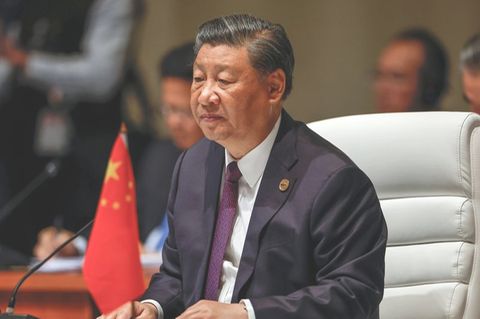Jahrzehntelang hat sich der Dalai Lama unermüdlich für die Belange Tibets eingesetzt, er ist um die Welt gereist und hat mit seiner Freundlichkeit und Friedfertigkeit für die Autonomiebestrebungen Tibets geworben. Viel erreichen konnte er aber nicht, China hält die Region unverändert fest im Griff. Jetzt hat der 75-Jährige seinen Rückzug als oberster Führer der tibetischen Exilregierung angekündigt. Die Bühne der Weltöffentlichkeit wird er aber deswegen noch lange nicht verlassen: Seine Rolle als geistliches Oberhaupt der Tibeter bleibt, und auch sein politischer Einfluss dürfte kaum schrumpfen.
Es war ein Schritt, der schon vor Monaten angekündigt worden war: Am Donnerstag nun gab der Dalai Lama selbst bekannt, er werde das tibetische Exilparlament bei seiner Sitzung kommende Woche bitten, ihm einen Rücktritt zu ermöglichen. "Seit den 1960er Jahren wiederhole ich immer wieder, dass die Tibeter einen Anführer brauchen, der frei vom Volk gewählt wurde und dem ich meine Macht übergeben kann", sagte er. "Heute ist eindeutig die Zeit gekommen, dies umzusetzen." Bereits 2001 hatten die Tibeter zum ersten Mal direkt einen Ministerpräsidenten als formalen Chef der Exilregierung wählen können, der Dalai Lama selbst bezeichnete sich seitdem als "halb-pensioniert".
Seine tatsächliche politische Macht war ohnehin von jeher beschränkt, der Mann, der stets in buddhistischer Mönchstracht und mit großer Brille auftritt, hatte vor allem als spiritueller Führer der Tibeter großen Einfluss. Eine Funktion, die er innehat, seit er denken kann: Bereits als Dreijähriger wurde der am 6. Juli 1935 als Lhamo Dhondrub geborene Sohn armer Bauern als Inkarnation des Dalai Lama entdeckt. Im Februar 1940 zog er als 14. Dalai Lama in den riesigen Potala-Palast in Lhasa ein.
Gerade einmal 15 Jahre alt war er, als er 1950 den Einmarsch der chinesischen Armee in Tibet erlebte und eiligst auch zum weltlichen Führer Tibets ernannt wurde. 1959 schlug China einen Aufstand blutig nieder und brach sein Versprechen, den Tibetern Autonomie zu gewähren. Für den Dalai Lama wurde es gefährlich. Der 24-Jährige floh mit seinem Gefolge über das Himalaya-Gebirge ins indischen Dharamsala, bis heute Sitz seiner Exilregierung.
Seitdem kämpft er aus dem indischen Exil heraus und auf seinen vielen Reisen um die Welt für eine friedliche Lösung der Tibet-Frage. Er trifft Staats- und Regierungschefs und nutzt geschickt die Macht der Medien. Im Fernsehen ist der humorvolle Mönch ein ebenso gern gesehener Gast wie in intellektuellen Gesprächsrunden. Die US-Filmindustrie widmete ihm mit "Kundun" und "Sieben Tage in Tibet" zwei große Kinofilme. Für seine Bemühungen um eine friedliche Lösung der Tibet-Frage wurde der Autor dutzender Bücher 1989 mit dem Friedensnobelpreis geehrt.
Von einer Unabhängigkeit spricht der Dalai Lama dabei nicht, ihm schwebt eine begrenzte Autonomie der unter chinesischer Herrschaft stehenden Himalayaregion vor. China bezichtigt ihn dennoch, eine Abspaltung Tibets zu betreiben. Seine Ankündigung, sich von der Leitung der Exilregierung verabschieden zu wollen, beschied eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking mit den Worten, es handle sich um einen "Trick", um die internationale Staatengemeinschaft zu täuschen. Tatsächlich dürfte der Dalai Lama, Rücktritt hin oder her, bis an sein Lebensende die dominierende politische Figur der Tibeter bleiben. Beobachter sehen den geplanten Rückzug eher als symbolischen Schritt. Und der Dalai Lama selbst versprach bereits, er werde weiter seine "Teil für die gerechte Sache Tibets leisten".