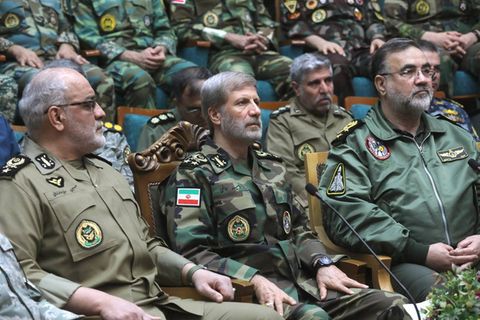Das Land hat von Anfang an Europas Geschichte entscheidend bestimmt. Schon das erste persische Großreich vor 2500 Jahren rühmte sich der Allmacht seiner Könige und trat in Widerspruch zur Freiheitsliebe der Griechen. Generationen deutscher Gymnasiasten haben sich mit den großen Schlachten gequält: Marathon (490 v. Chr.), Thermopylen (480 v. Chr.) und schließlich 333 - bei Issos Keilerei. Stets war es der Kampf edler Hellenen gegen despotische Perser, abendländischer Hochkultur gegen orientalische Rückständigkeit. Diese Schulbuchsicht verstellte den Blick auf die persische Kultur, die nicht nur eine moderne Staatsorganisation hervorbrachte und der Welt das Schach schenkte, das königliche Spiel, sondern die es auch vermochte, verschiedene Völker in einer Nation friedlich zu vereinen.
Die vermeintliche Überlegenheit des Westens verführte in den vergangenen Jahrhunderten die Kolonialmächte, nach Persien zu greifen. Doch keiner der Invasoren konnte sich lange in dem Staat halten, der sich seit 1935 Iran nennt - "Land der Arier". Auch die moderne Variante der Einflussnahme, der Sturz der gewählten Regierung in Teheran durch ein britisch-amerikanisches Geheimdienstkomplott 1953, bescherte dem Schah nur vorübergehend die Herrschaft auf dem Pfauenthron. Bis 1979 ein bärtiger Ayatollah zur Revolution aufrief und den Iran zum Gottesstaat machte. Einem Staat, der inzwischen nach der Atombombe greift und auf dem Weg ist, zur neuen regionalen Großmacht zu werden. Und für dessen Selbstverständnis die Hochzeit des persischen Reichs eine zentrale Rolle spielt - jene Phase, die mit König Kyros begann. Dem ersten Herrscher des Landes, dem die antiken Geschichtsschreiber den Beinamen "der Große" gaben.
Seine Herkunft bekommt in der Überlieferung, wie meist in solchen Fällen, legendäre Züge. Er sei der Sohn eines Wegelagerers und einer Ziegenhirtin gewesen. Nein, er sei von einer Wölfin gesäugt und aufgezogen worden.
Der Weg zur Macht
Tatsache ist, dass Kyros der Sohn eines persischen Kleinkönigs aus dem Geschlecht der Achaimeniden war, der in Abhängigkeit zum Reich der Meder stand. Meder und Perser sind beide indoeuropäische Volksstämme und nahe Verwandte. Die medischen Könige hatten Ende des 8. Jahrhundert v. Chr. auf der iranischen Hochebene ein Reich geschaffen, das mithilfe einer gut organisierten Beamtenschaft von einem allmächtigen Herrscher regiert wurde, "in dessen Gegenwart lachen und ausspeien allen verboten" war. Das Reich bestand über 100 Jahre. Bis Mitte des 6. Jahrhunderts das Wolfsblut auf den Plan tritt.
Kyros, dem jungen Fürsten wird allseits Klugheit, schnelle Auffassungsgabe, Aufrichtigkeit und auch noch blendendes Aussehen zugesprochen. "Die Götter sind auf seiner Seite", bemerkt der König von Babylon, der noch nicht ahnt, welche Konsequenzen das für ihn haben sollte. Zunächst zieht Kyros gegen die Meder ins Feld. Zu einer Schlacht kommt es nicht. Das medische Heer erhebt sich gegen seinen König, läuft über zur neuen Lichtfigur Kyros und übergibt ihm als Mitbringsel den gefesselten König.
Mit einem Schlag wird der bisherige Kleinfürst Kyros Herrscher eines Großreichs und regiert zur allgemeinen Überraschung so, wie es zum sympathischen Markenzeichen vieler Perserkönige werden sollte: mit relativem Großmut. Anders als etwa die Assyrer, deren Spezialität es war, die Besiegten zu häuten, zu verstümmeln oder als Zugtiere zu benutzen, schont Kyros das Leben der Meder und sogar das ihres Königs. Zwar kassiert er ihre Schätze und einen Teil ihrer Ländereien ein. Doch die Beamten können ihre Posten behalten, sie bekommen allerdings persische Aufpasser zur Seite gestellt, und die Soldaten werden seinem Heer eingegliedert. Obendrein übernimmt Kyros die Idee des medischen Herrschertums mit seinem höfischen Zeremoniell und der absoluten Königsmacht. Es ist, als bestünde das Mederreich weiter, nur jetzt unter neuer - persischer - Leitung.
Folgenschwere Herausforderung
Da fühlt sich Krösus, der sagenhaft reiche König von Lydien, berufen, Kyros herauszufordern. Als er das Orakel von Delphi befragt, scheint das seinen Plänen Erfolg zu verheißen: "Wenn du den Fluss Halys überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören."
Er überschreitet den Grenzfluss. Doch sein Heer wird zurückgeschlagen. Der Perserkönig Kyros dringt ins Reich des Krösus vor, erobert die Hauptstadt Sardes und steckt sie in Brand. Krösus hat ein großes Reich zerstört - sein eigenes. Er kommt in den Flammen um.
Jetzt gehört Kyros auch Kleinasien, die heutige Türkei. Was nun noch verlockend vor seinen Augen liegt, sind die weiten, fruchtbaren Ebenen des Zweistromlandes um Babylon und die Küsten des Mittelmeeres mit den Häfen und Schiffen der Phönizier.
Gnädiger Eroberer
Kyros schlägt das babylonische Heer und zieht dann kampflos in die Stadt ein. "Schilfzweige wurden vor ihm ausgebreitet, als er bei seinem Eintreffen den Frieden für das ganze Land verkündet", heißt es in zeitgenössischen Chroniken. Wieder lässt Kyros politisch Milde walten. Der besiegte König wird begnadigt und angeblich sogar als Provinzgouverneur weiterbeschäftigt. Den Israeliten, die nach einem verlorenen Krieg rund 50 Jahre in dem berühmten "babylonischen Exil" zugebracht hatten, ermöglicht er, nach Hause zurückzukehren. Seine Beamten durchstöbern sogar die Schatzkammern nach kostbarem Tempelgerät, das als Beute aus Jerusalem weggeschleppt worden war, und geben es an die Juden zurück. Der Großkönig macht sich beliebt im Nahen Osten.
Sein Sohn Kambyses II. führt das Eroberungswerk fort, besiegt die Ägypter und setzt sich als Pharao aus den persischen Bergen auf den Goldthron. Anders als sein Vater bleibt er den Chronisten als grausamer Herrscher in Erinnerung, der etwa, nur um seine Treffsicherheit zu zeigen, den Sohn eines Hofbeamten mit einem Pfeilschuss tötet. Nach nur acht Jahren Regierung stirbt er überraschend.
In den Wirren, die folgen, setzt sich ein entfernter Vetter des Kambyses durch. Dieser Darios erweist sich in seiner 36-jährigen Regierungszeit als so begabter und gerechter Regent, dass auch ihn das Prädikat "der Große" ziert. Als neuen Regierungssitz wählt er Susa, das am Rand der mesopotamischen Ebene liegt, doch in Sichtweite der iranischen Bergketten. Ein Sinnbild der Einheit, die Persien und das Zweistromland, heute Iran und Irak, für viele Jahrhunderte bilden sollten. Sein Herrschaftsgebiet erstreckte sich im Osten bis zum Aralsee und zum Indus, im Westen bis an den Bosporus und in Nordafrika über Ägypten hinaus bis ins heutige Libyen. Es war das bis dahin größte Reich der Welt. Zur selben Zeit - um 500 v. Chr. - war Rom noch ein bäuerlicher Kleinstaat in Mittelitalien. Die griechischen Stadtstaaten machten gerade mal ihre ersten demokratischen Gehversuche. Die germanischen Stämme kannten noch keine Schrift und keine Städte.
Auf einer Stufe mit Gott
Darios ist König und Gott, im verschwenderisch ausgestatteten Palast gewöhnlichen Menschen entrückt, abgeschirmt durch Wachen, Vorzimmerfluchten, Scharen von Höflingen. Wer bis zu ihm vordringt, hat sich auf den Boden zu werfen und sieht den König nur schemenhaft hinter transparenten Vorhängen. Lediglich hohe Adelige dürfen sich ihm auf Tuchfühlung nähern, ihn aber nur mit seitwärts gewandtem Gesicht und einer Hand vor dem Mund ansprechen, damit ihr Atem den höchsten Herrscher nicht belästige. Wer ohne Aufforderung redet, wird hingerichtet. "Von euch Griechen geht die Rede, dass ihr Freiheit und Gleichheit über alles schätzt. Bei uns aber ragt über viele treffliche Gesetze dieses als das Schönste hervor: den König zu verehren und vor ihm niederzufallen als dem Abbild Gottes, der alles schützt und erhält", lassen die Perser ihre Nachbarn wissen.
Dieser unnahbare Darios kümmert sich ganz handfest um gerechte Entlohnung der Handwerker, lässt Straßen bauen und schafft ein ausgeklügeltes Nachrichtensystem mit Lichtsignalen, die von Turm zu Turm weitergegeben werden, und berittenen Boten. Bewundernd schreibt Herodot über die persischen Postreiter: "Weder Schnee noch Regen, weder Hitze noch Nacht halten diese Kuriere davon ab, schnellstens ihren Auftrag auszuführen. Der erste Kurier übergibt seine Botschaft dem zweiten und so fort."
Darios ordnet die Provinzen neu und setzt dort als Statthalter sogenannte Satrapen ein. Häufig sind sie nicht Perser, sondern lokale Würdenträger. Zu deren Kontrolle ernennt er Inspekteure, die als "Augen des Königs" durchs Reich reisen und den Statthaltern auf die Finger sehen. Den diskreteren Teil der Überwachung erledigen die "Ohren des Königs". Diese ziehen im Gegensatz zu den "Augen des Königs" inkognito durchs Land und sind bei korrupten Funktionären besonders gefürchtet.
Hart aber gerecht
Das persische Recht straft unbarmherzig. Hinrichtungen werden durch Köpfen, Kreuzigung oder Pfählung vollzogen. Bei geringeren Vergehen drohen Ausbrennen der Augen oder Abhacken von Füßen oder Händen. Feigheit vor dem Feinde wird vergleichsweise milde geahndet. Verurteilte müssen einen Tag lang eine nackte Hure rittlings auf den Schultern durch den Basar tragen.
Doch die Strafen werden nicht nach dem unerbittlichen Auge-um- Auge-Prinzip verhängt. Herodot: "Wegen eines einzigen Vergehens lässt der Großkönig keinen hinrichten. Erst wenn er überlegt hat und findet, dass die Verfehlungen des Schuldigen die von ihm geleisteten Dienste an Zahl und Schwere überwiegen, gibt er seinem Zorn nach."
"Ich bin so geartet, dass ich das Recht liebe und das Unrecht hasse", wählt Darios als Grabinschrift. "Ich will nicht, dass der Schwache durch den Starken Unrecht erleidet, aber auch nicht, dass dies dem Starken durch den Schwachen widerfährt. Einem Lügner bin ich nicht Freund. Ich bin nicht jähzornig. Auch wenn es in mir kämpft, bezwinge ich meinen Zorn."
Stäker als erwartet
Diese wohlgeordnete Welt erschüttert plötzlich eine Macht, von deren Existenz Darios zuvor keine Notiz genommen hat. Er muss sich erst erkundigen, wer diese Athener überhaupt sind, die mit ihren Schiffen einen - erfolglosen - Aufstand griechischer Städte im persischen Kleinasien unterstützen. Darios schießt einen Pfeil gen Himmel: "O Gott, lass mich mit deiner Hilfe die Athener bestrafen!" Dann befiehlt er einem Diener, ihn bei jedem Abendessen zu ermahnen: "Herr, vergiss mir die Athener nicht!"
Was mit dieser theatralischen Geste beginnt, ist der berühmte Konflikt Griechen gegen Perser. Aus Sicht der Hellenen ein Kampf um Sein oder Nichtsein. Für das persische Großreich handelt es sich anfangs nur um eine Strafexpedition an seiner Peripherie, aus der ein kleiner Eroberungsfeldzug wird. Darios bleibt zu Hause in Susa und schickt bloß ein Armeekorps mit ein paar Tausend Mann über den Hellespont. Diese Streitmacht, so glaubt er, würde der seltsamen Griechen, die auf ihren Marktplätzen nur wild palaverten und chronisch uneinig seien, schon Herr werden.
Doch die Athener und ihre Bundesgenossen schlagen 490 v. Chr. auf der Ebene von Marathon das Invasionsheer. Darios will die Schande nicht auf sich sitzen lassen und rüstet auf. Da stirbt er.
Ein schwerfälliges Kriegsheer
Sein Sohn Xerxes nimmt die Sache in die Hand. Keine Strafexpedition mehr, nun geht es um die Unterwerfung Griechenlands. Mit einem riesigen Heer und einer ebenfalls gewaltigen Kriegsflotte seiner phönizischen, ägyptischen und lykischen Untertanen rückt er nach Europa vor. Antike griechische Geschichtsschreiber sprechen von über einer Million Soldaten, heute schätzt man, es seien etwa 200.000 gewesen. Ausnahmsweise können sich die traditionell verfeindeten Städte Athen und Sparta auf eine gemeinsame Verteidigung einigen. Athens Flotte solle die Schiffe der Perser neutralisieren, die Spartaner sollen sie zu Lande stellen.
Xerxes ist kein Darios, sein Heer nicht mehr die kriegserprobte Truppe von einst. Der Großkönig beschäftigt sich lieber mit den zahllosen Damen seines Harems als der Regierungsarbeit. Auch seine Offiziere halten inzwischen mehr vom süßen Leben als vom Kampf. "Sie leuchteten durch reichen Goldschmuck hervor. Reisewagen führten sie mit sich, in denen sich ihre Kebsweiber und eine große, wohl ausgerüstete Dienerschaft befanden", schreibt Herodot.
Wie jeder Gymnasiast aus den Schulbüchern weiß, halten die Spartaner am Thermopylen-Pass die gegnerische Übermacht so lange auf, bis der Athener Flottenführer Themistokles seine Heimatstadt evakuieren kann. Bei Salamis kann er dann die schwerfälligen persischen Kriegsschiffe in der engen Bucht schlagen.
Fatale Prunksucht
Von seinem goldenen Thron auf einem Felsvorsprung am Ufer muss Xerxes mit ansehen, wie sich die schwer manövrierbaren Schiffe der Perser in dem engen Gewässer heillos verheddern und sich die leichten Ruderboote der Griechen mit ihren Rammspornen auf sie stürzen. Nach ein paar Stunden ist die Schlacht verloren und damit auch der Krieg, den die Griechen "für die Ehre und Freiheit ihres Landes, ihrer Kinder, Frauen, Ahnengräber und die Götter der Väter" (Themistokles) geführt hatten. Persiens Expansion nach Europa ist gescheitert.
Xerxes hakt die Niederlage als bedauerliche Randerscheinung ab und wendet sich noch intensiver den schönen Dingen zu: seinem Harem und dem Ausbau von Persepolis. Die Königsstadt in den iranischen Bergen soll anders als Susa nicht Regierungssitz, sondern strahlende Kultstätte der achaimenidischen Herrlichkeit werden.
Prunksucht und Bauwut des Xerxes und seiner Nachfolger höhlen die Finanzen aus und schwächen das Heer. 465 wird Xerxes, der König der Könige, von seiner eigenen Palastwache im Bett ermordet. 100 Jahre nach dem Aufstieg der Achaimeniden beginnt der langsame, doch unaufhaltsame Niedergang. Nahezu sämtliche Nachfolger des Xerxes sterben eines gewaltsamen Todes. Im Königspalast herrscht zunehmend Dekadenz. Da werden unbotmäßigen Höflingen die Augen ausgestochen oder die Ohren mit flüssigem Blei gefüllt. Die Gattin eines Großkönigs lässt ihrer Schwägerin Nase, Ohren, Zunge, Lippen und Brüste abschneiden und schickt die Verstümmelte dann an deren Gatten zurück.
Der Siegeszug von Alexander
"Die Macht der Perser und ihrer Könige erschöpft sich in Unmengen von Gold, in Prasserei und schönen Frauen, ansonsten ist sie nichts als hohler Pomp und eitle Prahlerei", befindet der griechische Historiker Plutarch später. Derartige Nachrichten erreichen auch einen blutjungen Mann namens Alexander, seit 336 König des halbgriechischen Volks der Makedonen.
Als Alexander König wurde, regierte in Susa Darios III. Mord hat ihn auf den Thron gebracht, den er sich vorerst sichert, indem er eigenhändig den Mörder seines Vorgängers umbringt. Der Großkönig hört bald von den Eroberungsplänen des ehrgeizigen jungen Manns aus Europa, der es innerhalb weniger Jahre fertiggebracht hat, die widerspenstigen griechischen Städte unter seine Oberhoheit zu zwingen. Doch selbst als der Makedonenherrscher mit einem kleinen, äußerst schlagkräftigen Heer in Kleinasien einfällt, reagiert Darios III. mit der Arroganz des allmächtigen Gottkönigs und überlässt die Abwehr des Feindes nach Väter Sitte den Satrapen. Erst als seine Statthalter 334 die erste Schlacht verlieren, nimmt der "König der Könige" aus dem "Samen der Götter" selbst den Kampf auf. Trotz zahlenmäßiger Überlegenheit verliert er gegen das Feldherrengenie und den selbstmörderischen Ehrgeiz Alexanders die beiden Schlachten von Issos und Gaugamela. Noch bevor seine Truppen endgültig geschlagen sind, ergreift Darios die Flucht. Seine Familie gerät in Gefangenschaft. Er selbst rettet sich in den Ostteil seines Reiches. Dort lässt ihn später Bessos, der Statthalter der östlichen Provinz Baktrien, beim Herannahen Alexanders umbringen.
Nun trägt der Europäer Alexander das persische Königsdiadem, kurbelt mit dem erbeuteten unermesslichen Kronschatz die Wirtschaft seines Reiches an, heiratet eine persische Prinzessin, verlangt von seinen makedonischen Kampfgefährten den orientalischen Kniefall und tut auch sonst alles, um als legitimer Nachfolger der Achaimeniden angesehen zu werden. Für Darios III. richtet er ein Staatsbegräbnis aus, den Bessos bestraft er grausam. Der Königsmörder muss sich nackt an den Straßenrand stellen, Alexander fährt vorbei und fragt ihn aus dem Streitwagen heraus: "Warum hast du Darios umgebracht?" Dann befiehlt er, Bessos Ohren und Nase abzuschneiden und ihn an einen Bruder des toten Königs zu übergeben. Der ließ Bessos, je nach Quelle, kreuzigen oder in Stücke reißen.
Das parthische Königreich
Nach über 200 glanzvollen Jahren war das Persische Weltreich Geschichte. Für lange 500 Jahre wird das Land Provinz. Wirtschaftlich wichtig, aber doch Peripherie in einem Reich, das weit nach Westen reicht.
Nach Alexanders frühem Tod 323 gelingt es Seleukos, einem seiner Generäle, sich fast aller asiatischen Eroberungen des Makedonenkönigs zu bemächtigen. Die Dynastie der Seleukiden regiert dann etwa 200 Jahre vom Irak aus. Die Iraner wie die Iraker haben kein Bürgerrecht und können nur in Ausnahmefällen in der Hierarchie nach oben kommen.
Als dann die Seleukiden den Fehler machen, sich mit der aufstrebenden Weltmacht Rom anzulegen, und dabei empfindliche Niederlagen kassieren, schwindet ihre Machtbasis. Sie können dem Druck der Parther, eines indoeuropäischen Volks aus dem Kaukasus, auf die Dauer nicht standhalten. Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. sind die Parther die Herren Persiens. Sie behalten Griechisch als Amtssprache bei, bauen viele ihrer Tempel im hellenistischen Stil und führen in ihren Theatern Stücke von Sophokles und Euripides auf - wenn auch nur für eine dünne städtische Oberschicht. 500 Jahre kann sich das parthische Königreich dank eines schlagkräftigen Heeres und autoritärer Unterdrückung behaupten. Dann löscht es ein persischer Vasall des Partherkönigs aus. Ardaschir I. aus dem Haus der Sassaniden besteigt nach einem siegreichen Feldzug, der mit dem Tod des letzten Partherkönigs endet, um 250 n. Chr. den Thron.
Schwere Krone
Die Könige des "Neupersischen Reichs" wollen dem Land sein großes Erbe zurückgeben. Ardaschir behauptet, von Kyros und Darios abzustammen. Er besucht die Ruinen der alten Königsstadt Persepolis und führt Persisch als Amtssprache ein. Und er regiert wieder von Mesopotamien aus. Auch Pracht und Herrscher-Herrlichkeit treiben die Sassaniden erneut auf die Spitze. Bittsteller müssen sich auf dem Bauch liegend nähern und den König mit der Formel anreden: "Möget ihr unsterblich sein, erster der Menschen." Die Krone besteht aus mehr als einem Zentner Gold, in das Perlen, angeblich in Rabeneier-Größe, und blutrote Rubine eingelassen sind. So schwer ist diese Krone, dass sie an langen Goldketten von der Palastdecke herunterhängt, gerade tief genug, das königliche Haupt zu berühren.
Wie schon die Zeit der Achaimeniden hat auch die Ära der Sassaniden zwei Gesichter. Einerseits kümmern sich die meisten Könige um das Wohlergehen ihrer Untertanen. Sie bauen Straßen und Brücken, legen neue Häfen an, fördern Handwerk und Handel und versuchen, gerecht zu regieren. Über das Sassanidenreich gelangen aus dem fernen Osten das Schach- und das Polospiel nach Europa. Chosrau I., der größte in der Reihe der 25 Sassabiden-Könige, versammelt an seinem Hof Gelehrte aller Nationalitäten und Religionen. Zu ihm flüchteten sich "heidnische" Philosophen aus Griechenland, für die im inzwischen christlichen Römischen Reich kein Platz mehr ist. Chosrau ordnet an, die Schriften von Platon und Aristoteles ins Persische zu übersetzen. So wurden sie vor dem Vergessen bewahrt, erst Jahrhunderte später kamen sie über die arabische Gelehrtenwelt wieder ins christliche Abendland zurück.
Andererseits sind Herrscher wie der kulturell so tolerante Chosrau orientalische Despoten mit uneingeschränkter Gewalt über Leben und Tod. Auf der Hut vor Palastintrigen und Verschwörungen bringt fast jeder neue Herrscher gleich nach der Thronbesteigung nahe Verwandte um und schaltet so die mögliche Konkurrenz aus.
Ruf nach Gleichheit
Manchmal jedoch erweisen sich die Despoten großzügig in ihrer grenzenlosen Willkür, wie etwa Bahram II. Der König hatte schon die Hinrichtung eines Dieners angeordnet, weil ihm etwas Soße aus einer zu vollen Terrine auf die Hand getropft war. Da packt der Mann die Schüssel und kippt sie dem König über das herrscherliche Haupt: "Wenn ich schon hingerichtet werde, dann soll es sich wenigstens lohnen." Bahram II., so die Überlieferung, musste lachen und schenkte dem Mann das Leben.
So viel Prunk und Selbstherrlichkeit ruft auch Kritiker auf den Plan. Während der Regierungszeit von König Ghobad (483-531 n. Chr.) bekommt ein Prediger namens Mazdak ungeheuren Zulauf. Besonders den Armen gefällt seine Lehre: alles Böse wurzele in Elend und Neid. Daher müsse man das Privateigentum abschaffen, jedem solle alles gehören, die Reichtümer müssten gerecht auf das gesamte Volk verteilt werden. Auch die Frauen der Reichen müsse man zumindest für eine gewisse Zeit den Armen überlassen. Und wer eine hässliche und zänkische Gattin habe, der solle sie vorübergehend für eine schöne und sanfte Frau eintauschen können.
Der König unterstützt anfangs diese neue Lehre, weil er die Macht der Edelleute brechen will. Doch die setzen den Herrscher kurzerhand ab und werfen ihn ins Gefängnis. Ghobads Frau gelingt es, ihren Mann in einen Teppich eingerollt aus dem Kerker zu schmuggeln. Ghobad, ein nüchterner Realpolitiker, schwenkt um. Der Frühsozialist Madzak wird festgenommen und hingerichtet.
Ewiger Kampf der Supermächte
Die Außenpolitik des Großreichs ist in jener Zeit geprägt von der Auseinandersetzung mit der zweiten Supermacht der Antike, dem Römischen Reich. Die demütigendste Niederlage fügt Schapur I. den Römern 260 n. Chr. zu. Bei Edessa in Nordmesopotamien schlägt er den römischen Kaiser Valerian und verschleppt ihn in die Gefangenschaft. Dort wird der Imperator zum Sklaven. Immer wenn Schapur sein Pferd besteigt, muss Valerian auf alle viere gehen und dem Sassaniden als Fußschemel beim Aufsitzen dienen. Von da an ist das persische Heer mit seinen schwer gepanzerten Reitern gefürchtet. "Sie standen so dicht, dass die den Körpern eng anliegenden Eisenplatten den Blick der Gegner durch ihren Glanz blendeten. Hinter ihnen schritten Elefanten einher, so hoch wie Berge, und mit der Bewegung ihrer ungeschlachten Körper drohten sie Verderben an", notieren Chronisten.
Zu Beginn des 7. Jahrhunderts erobern die Sassaniden Jerusalem und nehmen zum Entsetzen der Christenheit das Heilige Kreuz als Beute mit. Sie stoßen sogar bis an den Bosporus vor und belagern Konstantinopel. Dem oströmischen Kaiser glückt der Gegenstoß, und er gewinnt alle verlorenen Gebiete zurück. Die Perser müssen das Heilige Kreuz herausgeben. Im Frühjahr 630 wird es unter dem Jubel des Volks wieder in Jerusalem aufgerichtet.
Insgesamt währte der Konflikt mit Rom rund 400 Jahre bis zum Sturz der Sassaniden. Er endete unentschieden. Die Kaiser in Rom und später in Konstantinopel konnten ihr Imperium auf Dauer nicht bis ins Zweistromland vorschieben. Umgekehrt gelang es den Sassaniden nie, die Römer aus Syrien und Kleinasien zu vertreiben.
Doch während sich die historischen Widersacher zerfleischten, schickte sich in der arabischen Wüste ein Mann an, die Welt im Namen Allahs umzukrempeln und zur Nemesis für beide Großmächte zu werden. Der Mann hieß Mohammed.